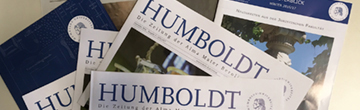Nachruf an Rainer Neumann
"Sie werden verstehen, dass ich mich fachlich hierzu nicht äußern kann, aber ich gebe folgendes zu bedenken...": Diese Worte Rainer Neumanns sind einer großen Zahl jener Professoren, die zwischen 1992 und 1999 an die Humboldt-Universität berufen worden, im Gedächtnis geblieben. Zumal sie meist von erstaunlich treffenden Überlegungen zu den angesprochenen Sachfragen gefolgt wurden. Als Kanzler der Universität hatte er die Forschungsleistungen, die Verwaltung und die Finanzen gleichermaßen im Blick, was die Dauer der Verhandlungen wie auch die Durchsetzung der erreichten Ergebnisse ungeheuer beschleunigte. Wenn in seiner Amtszeit mit knapp 600 meist erfolgreichen Berufungsverfahren alle Rahmen gesprengt wurden, dann lag dies an seiner Fähigkeit, alle drei Komponenten zusammenführen zu können.
Wie den gordischen Knoten lösen?
Unter DDR-Bedingungen hatte die Humboldt-Universität den Status einer Eliteeinrichtung besessen. Bei jedem Gespräch und jeder Entscheidung wurde deutlich, dass Rainer Neumann deren höchst problematische Umwandlung in eine Massenuniversität westdeutscher Prägung mit jenem Anspruch verband, den die Geschichte und der Name der Universität vorgaben. Er handelte während seiner Amtszeit in einer Sphäre von unlösbaren Widersprüchen, die teils nur wie der Gordische Knoten zu behandeln waren, ohne dass er sich diese Spannungen hätte anmerken lassen. Rainer Neumann hatte starke Meinungen, aber selbst im Streit verließ das Gegenüber nie das Gefühl, ernst genommen und geschätzt zu werden: dies war meines Erachtens die Bedingung dafür, dass die Universität bei ihrem Ritt über den Bodensee nicht einbrach.
Aus einem selbstlosen Vertrauen darauf, dass auch fundamentale Gegensätze aufzuheben seien, betrieb Rainer Neumann, der in den ersten Jahren in dem Juristen Hasso Hofmann einen überzeugten, ähnlich veranlagten Mitstreiter fand, auch die Reorganisation der zuvor nach Fachbereichen gestalteten Universität nach Fakultäten. Eine große Zahl von Professoren, und so ich selbst, wurde auf die kleineren Organisationen von Fachbereichen hin berufen, um sich bei Dienstantritt einigermaßen perplex in den großen Einheiten der Fakultäten wiederzufinden.
Ein riesiges Experiment mit viel Energie und wenig Geld
Nicht weniger erstaunlich war die Neuorganisation der Verwaltung, die nicht zu Rainer Neumanns voller Zufriedenheit gelingen konnte, die aber ebenfalls eine erstaunliche Leistung darstellte, zumal sie zunächst von den Verstrickungen mancher Teile der Universität in die Staatssicherheit bestimmt waren. Die psychologischen Verwerfungen waren von einer Dimension, dass er es lange nach seiner Pensionierung einmal als ein Wunder bezeichnete, kein Zeuge von Gewaltakten geworden zu sein. Er war von einer bezwingenden Sachorientiertheit, die ihm auch bei Gegnern, wie er sie zu Beginn vor allem in der Senatsverwaltung für Wissenschaft und Forschung antraf, eine Anerkennung verschaffte, die sich in Hochachtung verwandelte. Sie trug wesentlich dazu bei, dass es dem Präsidenten Hans Meyer gelang, der Universität im Rahmen der Erprobungsklausel und der bald folgenden Hochschulverträge ein neues Maß an Autonomie zu verschaffen. All seine Tätigkeiten vollzog er in einer Situation der Geldknappheit, in der jeder der Beteiligten, von der Verwaltung bis zur Universitätsleitung, vom Zwiespalt bestimmt wurde, an einem riesigen Experiment beteiligt zu sein, das alle Energien entfaltete, das aber zugleich mit ständigen Kürzungen der Zuschüsse zu kämpfen hatte. Diesen Konflikt hat niemand stärker aushalten müssen als Rainer Neumann.
Mitarbeiter der Ständigen Vertretung in Ostberlin
An der Reformuniversität Konstanz hatte er in den sechs Jahren vor seiner Berufung die Funktion eines Vizekanzlers inne, was ihn für seine Aufgaben an der Humboldt-Universität prädestinierte. In psychologischer Hinsicht aber war es insbesondere seine vorherige Tätigkeit als Mitarbeiter der Ständigen Vertretung der BRD in Ostberlin, die ihn auf seine Tätigkeit vorbereitete. In dieser Ersatz-Botschaft wurde er mit den Verhältnissen der DDR vertraut, und von hier aus lernte er neben den Schwächen des Systems auch die Stärken zahlreicher Persönlichkeiten kennen. Als er an die Humboldt-Universität kam, konnte er an Bekanntschaften anknüpfen, die er knapp zehn Jahre zuvor geschlossen hatte. Seine Tätigkeit in der Ständigen Vertretung war auch durch sein starkes Interesse an der Kunst geprägt, das unter anderem dazu beitrug, dass Joseph Beuys dort 1981 seine legendäre Ausstellung realisieren konnte, die unter ostdeutschen Künstlern und Intellektuellen ein starkes Eocho fand.
Legendäre Doppelkopfrunde im "Orange"
Die Jahre der Tätigkeit von Rainer Neumann haben eine unverwechselbare Epoche der Humboldt-Universität geprägt. Er hat immer betont, seine Gestaltungen in Gemeinschaften geführt zu haben, ohne die er machtlos gewesen wäre. In der Senatsverwaltung waren es insbesondere Senator Manfred Erhard und Ellen Fröhlich, während es innerhalb der Universität, über die Präsidentschaften von Heinrich Fink, Marlies Dürkop und Hans Meyer hinweg, die Abteilungsleiter Frank Eveslage, Andreas Kreßler, Peter Schirmbacher und Ewald Schwalgin waren, welche diese Gemeinschaft ausfüllten. Mit den drei letztgenannten verband Rainer Neumann nach seinem Ausscheiden eine legendäre Doppelkopf-Runde, zu der ich später selbst hinzustoßen konnte. Die Abende im heute nicht mehr existierenden Lokal "Orange" in der Ornanienburger Straße, die während der Partien immer wieder durch Erinnerungen an eine unvergleichliche Zeit ausgefüllt wurden, bleiben die lebendigste Erinnerung.
Eine Büste zu Ehren
Die Tradition, den Präsidenten und herausragenden Mitgliedern der Universität ein Gemälde oder auch eine Marmor- oder Bronzebüste zu widmen, hat diese alma mater zu einem veritablen Museum der modernen Portraitkunst gemacht. Sie ist nach 1989 abgerissen. Es wäre zu wünschen, dass diese, beginnend mit Marlis Dürkop, der ersten Präsidentin, wieder aufgenommen würde. Als erster der Nicht-Präsidenten hätte es Rainer Neumann verdient, auf diese Weise geehrt zu werden. Sein charakteristischer Kopf war wie geschaffen für eine Büste.
Autor: Horst Bredekamp, Kunsthistoriker