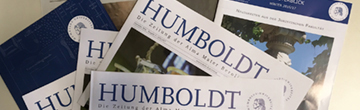Vom staubigen Boden zum Friedensbrot: Roggenaussaat auf dem ehemaligen Mauerstreifen
In Berlin liegt der weltweit einzige Acker im Zentrum einer Metropole. „Hier sieht man im städtischen Umfeld, dass wir uns nicht nur in wissenschaftlichen Tempeln bewegen, sondern als Universität auch universell unterwegs sind“, sagt Michael Baumecker, Leiter der Lehr- und Forschungsstation Freiland auf den Versuchsfeldern der HU in Dahlem und Thyrow. Das Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften der Lebenswissenschaftlichen Fakultät unterstützt freiwillig die Aussaat, Pflege und Ernte von Roggen auf zwei Feldern links und rechts der Kapelle der Versöhnung, auf dem ehemaligen Mauerstreifen. Baumecker hat am 17. September zum 20. Mal Roggen ausgesät. „Wir haben den Acker als HU immer unterstützt, um der städtischen Bevölkerung Landwirtschaft mal mitten in ihrem urbanen Umfeld zu zeigen. Viele Berliner und auch viele ausländische Besucher sind völlig überrascht, dass so etwas mitten in der deutschen Hauptstadt möglich ist.“
Im Krieg gibt es keine Landwirtschft
Baumecker ist seit Beginn des Projekts 2006 dabei, das 2005 als Kunstauktion von einem Bildhauer konzipiert worden war. „Seitdem gelingt es uns, das Projekt auf dem Gelände der Gedenkstätte Berliner Mauer durchzuführen, die uns auch finanziell unterstützt.“ Auch der Verein FriedensBrot e.V. ist daran beteiligt, der von einem Teil der Ernte zusammen mit Getreide aus anderen Ländern Europas sein „Friedensbrot“ aus Roggen backen lässt. „Der Acker wird zunehmend als Symbol für das europäische Zusammenwachsen gesehen, für die friedliche Nutzung eines ehemaligen Konfrontationsstreifen zwischen zwei militärischen Blöcken, zwischen Ost und West“, sagt der Agrarwissenschaftler. „Krieg in Europa war bis vor kurzem völlig unvorstellbar. Daher ist es wichtig, der Gesellschaft bewusst zu machen, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist. Im Krieg kann keine Landwirtschaft durchgeführt werden und dann gibt es auch kein Brot.“ Das Roggenfeld auf dem ehemaligen Todesstreifen versinnbildliche das. „Mit diesem Acker wollen wir das Symbol für diesen Zusammenhang in die Gesellschaft senden.“
Herausforderung städtischer Boden
Die HU-Mitarbeiter hatten den letzten Roggen im Juli geerntet und danach die Stoppeln eingearbeitet. Am 17. September haben sie mit einem kleinen grünen Traktor und einer kleinen grünen Drillmaschine mit zehn Säscharen den nächsten Roggen ausgesät, die Sorte Conduct, mit 300 Körnern pro Quadratmeter. Wenn der Roggen wächst und es grün wird, fahren sie mit dem Unkrautstriegel über das Feld und im Frühjahr streuen sie Mineraldünger, damit das Getreide auf dem sehr wenig fruchtbaren Boden auch wachsen kann. Denn 1985 war hier die ehemalige Versöhnungskirche abgerissen worden, die mitten auf dem Mauerstreifen stand. Daher ist der Boden die große Herausforderung für die Agrarwissenschaftler: „Wir haben hier einen städtischen Boden, der durch die urbane Nutzung natürlich kein typischer Ackerboden ist, sondern ein sehr anthropogen beeinflusster.“
Biodiversität auf ehemaligem Grenzstreifen
Darin liegen die Schuttreste der ehemaligen Backsteinkirche. „Die machen dem Roggen das Leben natürlich nicht unbedingt einfacher“, sagt Baumecker. Außerdem befinde sich der Acker teilweise auf dem alten Weg der Grenztruppen, die hier ihre Kontrollfahrten gemacht haben. „Da haben wir natürlich das besondere Problem, dass das Wasser nicht versickern kann und wir nach Regen nasse Stellen haben.“ Um die die Qualität des schwierigen Bodens zu verbessern, bauen die HU-Mitarbeiter im August auf einem Drittel des Ackers blau-violett blühende Luzerne an, die Stickstoff bindet. „Dazu kommt noch ein weiterer Effekt“, sagt Michael Baumecker. „Die Luzerne ist sehr attraktiv für Bienen und Schmetterlinge und trägt dazu bei, die Biodiversität im urbanen Raum zu erhöhen.“
Vom staubigen Boden bis zum Friedensbrot
Jetzt im September sieht man nur staubigen Boden, sagt Baumecker. „Nach der Aussaat wird er den Winter über eine schöne grüne Farbe haben.“ Ende Februar, Anfang März beginnt der Roggen zu wachsen und einen Monat später könnten sich schon kleine Hunde im Feld verstecken, weil das Getreide schon 20 bis 30 Zentimeter hoch sei. Ende Mai ist er dann ausgewachsen und rund anderthalb Meter hoch. Wenn die Pollenschüttung losgeht, wehen kleine Staubwolken über das Feld. Dann wachsen die Körner, bis zu hundert Körnern kann eine Ähre entwickeln. Danach setzt der Reifeprozess ein, das Korn wird trockener und verfärbt sich ins Gelbliche. „Diese Gelbreife ist meist so Ende Juni erreicht. Anfang Juli werden auch die Halme gelb und die Körner hart und graugrün. Und wenn dann eine Restfeuchte von 14 Prozent im Korn erreicht ist, ist es Zeit mit dem Mähdrescher im Feld zu sein, um die Körner dann aus den Ähren zu dreschen.“ Ein Teil der Ernte wird dann wieder zu Friedensbrot verbacken.
Autorin: Vera Görgen