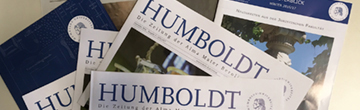„Die Weihnachtsgeschichte spiegelt das menschliche Grundbedürfnis nach Gerechtigkeit“

Prof. Dr. Markus Witte. Foto: privat
Herr Witte, seit wann erzählen sich Menschen die Weihnachtsgeschichte?
Markus Witte: Die eine Weihnachtsgeschichte gibt es gar nicht. Im Neuen Testament und im antiken Christentum wird vielfältig und unterschiedlich davon erzählt, wie Gott in der Welt erschienen ist oder wie er Mensch wurde. Aber Sie meinen natürlich die Erzählung, wie Jesus als Sohn von Maria und Josef in einem Stall in Bethlehem zur Welt kommt, die der Evangelist Lukas vermutlich zwischen 90 und 100 nach Christus verfasst hat.
Weiß man, wie Lukas auf die Geschichte kam?
Anhand von literarischen Analysen kann man zeigen, dass Lukas auf ältere Traditionen und Geschichten zurückgriff; vielleicht auch auf solche, die man sich in seiner Gemeinde erzählte. Daraus schuf Lukas aber etwas ganz Neues. Er schrieb die regionale Geburt Jesu in weltgeschichtliche Horizonte ein. Dafür nutzte er viele Motive, auch solche, die eng mit der römischen Kaiserideologie verbunden waren, zum Beispiel das Motiv eines heilvollen Herrschers, der der ganzen Welt Frieden bringt. Dabei betont Lukas den Kontrast zwischen der politischen Macht des römischen Kaisers und dem ganz anderen Auftreten des künftigen Heilands aus der Dynastie Davids: Der eine wird in einem Palast geboren, der andere in einem Stall, nicht im Zentrum, sondern an der Peripherie des Römischen Reichs.
War Weihnachten seit den Anfängen des Christentums ein wichtiges Fest?
Für die Zeitgenossen Jesu war die unmittelbare Gottesnähe wesentlich, die sie in Jesu Gegenwart spürten. Sie erlebten, dass diese Gottesnähe auch nach dem Tod Jesu nicht endete. Deshalb war in der alten Kirche zunächst Ostern als Fest der Auferstehung das wichtigste Fest. Die Geburt Jesu und ihre Feier gewannen erst später an Bedeutung. Allerdings nicht nur in der Tradition der lukanischen Erzählung, sondern auch, wie Matthäus sie in seinem Evangelium schildert: Dort spielt der Besuch der drei Könige, eigentlich dreier Magier, beim neugeborenen Jesus und dessen Anbetung eine besondere Rolle. Diese Erzählung prägt heute den Inhalt des orthodoxen Weihnachtsfestes, während sie in den westlichen Kirchen ihren Ort im Epiphaniasfest gefunden hat, dem sie ursprünglich auch in der Ostkirche angehört hatte.
Wieso wurde Weihnachten dann später zu einem zentralen Fest?
Im dritten Jahrhundert nach Christus feierten die Römer den Kult des Gottes Sol Invictus. Sie verehrten die unbesiegte Sonne, die jedes Jahr zur Wintersonnenwende erscheint und das Dunkle ablöst. In dieser Zeit erlangte das Christentum sukzessiv die politische Macht. Dabei absorbierte es das pagane Fest, das nach heutiger Zeitrechnung auf den 25. Dezember fiel. Hierbei knüpfte die christliche Idee vom Gottessohn als Licht, das Gerechtigkeit und Frieden bringt, an alte biblische, aber auch außerbiblische Vorstellungen an. So verehrte man zum Beispiel auch im alten Ägypten und in Mesopotamien einen Sonnengott. Und in der israelitisch-jüdischen Tradition begegnen Vorstellungen von Gott als eines Gerechtigkeit schaffenden Sonnengottes oder von der Sonne der Gerechtigkeit, die alles ans Licht bringt.
Ist es diese Hoffnung auf Gerechtigkeit, die das Weihnachtsfest so attraktiv gemacht hat - auch für Gläubige anderer Religionen?
Die Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Frieden, die Hoffnung, dass kein Hunger herrscht, dass es keine wirtschaftlichen Krisen gibt, dass Seuchen überwunden werden: Diese Grundhoffnungen verbinden uns Menschen, heute wie vor 2000 Jahren. Nun kann man immer wieder beobachten, dass sich Feste an andere Kulturen anpassen und in andere Kulturen einfügen. Die Figuren tragen dann andere Gewänder oder haben andere Gesichter. Aber die Grundstruktur der Erzählung bleibt, so im Fall der Weihnachtsgeschichte: Das Licht löst das Dunkel ab. Das Gute siegt über das Böse. Der Tod kann überwunden werden. Insofern strahlt die Bedeutung von Weihnachten weit über christliche Horizonte hinaus.
Wurde Weihnachten früher anders gefeiert? Heute wird oft kritisiert, dass Weihnachten ein Fest des Konsums geworden ist.
Die Geschichte der Weihnachtsbräuche ist sehr groß und regional sehr unterschiedlich. Ganz grob kann man sagen, dass man im Mittelalter und auch noch in der frühen Neuzeit stärker mit öffentlichen Ritualen feierte, zum Teil auch mit öffentlichen Verkleidungen und Festumzügen. Als Familienfest ist Weihnachten recht jung. Auch der Weihnachtsbaum und der Adventskranz sind neuere Zutaten. Das gegenseitige Beschenken als Ausdruck von Freude ist ein Grundelement menschlichen Lebens und Miteinanders. Insofern gehören Geschenke zu Weihnachten, auch wenn sie frömmigkeitsgeschichtlich häufig mit anderen Figuren, zum Beispiel mit Nikolaus, verbunden sind.
Für viele Menschen ist Weihnachten ein geselliges Fest, das man im Kreis der Familie feiert oder im gut besuchten Gottesdienst. Das birgt leider im Moment gewisse Risiken. Wie wichtig ist Gemeinschaft für das Weihnachtsfest?
Gemeinschaft ist wichtig, aber es kommt nicht auf ihre Größe an. Laut Lukas waren auch bei Jesus‘ Geburt nur ganz wenige Menschen anwesend. Aber dann haben Engel und Hirten, die Nachricht in die Welt getragen. Selbst wenn der Kreis der Feiernden klein ist, strahlt die Botschaft sehr viel weiter. Ihre Verbreitung liegt gar nicht in unserer Verfügung. Und selbst wenn wir in diesem Jahr wieder nur in kleinem Kreis und umgeben von besonderer Ungewissheit feiern, können wir darauf vertrauen, bei Gott in guten Händen zu sein.
Die Fragen stelle Stefanie Hardick.
Professor Dr. Markus Witte ist Inhaber des Lehrstuhls für Exegese und Literaturgeschichte des Alten Testaments und Dekan der Theologischen Fakultät an der Humboldt-Universität zu Berlin.