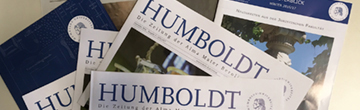„Sie hat frischen Wind in die Hochschulen gebracht“
Podiumsdiskussion am 16. Juni 2015
Video: Computer- und Medienservice der Humboldt-Universität zu Berlin
Ihr „Bergfest“ haben die vielen ausgezeichneten Projekte der Humboldt-Universität gerade hinter sich gelassen. Seit zweieinhalb Jahren wird die Hochschule in der dritten Runde der Exzellenzinitiative gefördert. Als eine von insgesamt elf in Deutschland erhält sie auch eine Förderung für ihr Zukunftskonzept „Bildung durch Wissenschaft. Persönlichkeit - Offenheit – Orientierung“. Doch von vornherein war die Freude darüber mit einer zeitlichen Befristung gekoppelt: Wenn die Exzellenzinitiative im Jahr 2017 ausläuft, endet die Förderung.
Im Jahr 2017 endet die Exzellenzinitiative in ihrer derzeitigen Form. Das trifft auch die Humboldt-Universität zu Berlin (HU). In einer engagierten Runde diskutierten am 16. Juni acht Wissenschaftsprofis über die Erfahrungen mit dem Förderinstrument und warfen einen Blick nach vorn.

Es diskutierten (von links nach rechts): Heike Schmoll, Moderation / FAZ; Dr. Inge Paulini, Mitglied Wissenschaftlicher Beirat HU Berlin; Prof. Dr. Christian Thomsen, Präsident TU Berlin; Edelgard Bulmahn, Bundesministerin a.D, Vizepräsidentin Deutscher Bundestag; Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz, Präsident HU Berlin; Steffen Krach, Staatssekretär für Wissenschaft, Berlin; Prof. Dr. Peter Strohschneider, Präsident Deutsche Forschungsgemeinschaft; Prof. Dr. rer. nat. Axel Freimuth, Rektor Universität zu Köln.
Foto: Mark Wagner
„Die Exzellenzinitiative steht nun also an einem Scheideweg“, sagte HU-Präsident Jan-Hendrik Olbertz am Dienstag, 16. Juni 2015. „Wir wissen zwar, dass sie fortgeführt werden soll.“ Doch wohin es in Zukunft gehe, wisse man derzeit nicht. Zur Halbzeit der aktuellen Förderperiode fand deshalb eine Podiumsdiskussion an der HU statt. Darin sollte nicht nur zurück, sondern auch nach vorn geblickt werden.
Jan-Hendrik Olbertz, Präsident der Humboldt-Universität zu Berlin
Video: Computer- und Medienservice der Humboldt-Universität zu Berlin
Sieben Wissenschaftsmanager diskutierten miteinander, was die Initiative bewirkt hat und wie es mit den Graduiertenschulen, den Clustern und Zukunftskonzepten weitergehen könnte: Welche Veränderungen hat die Initiative an den Hochschulen und im deutschen Wissenschaftssystem bewirkt? Welche ist sie schuldig geblieben? Welchen Herausforderungen müssen sich die Universitäten künftig stellen? Das waren einige der Fragen, die die Moderatorin Heike Schmoll, Wissenschaftsredakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, an die Runde richtete.
Edelgard Bulmahn
Video: Computer- und Medienservice der Humboldt-Universität zu Berlin
Eingeleitet wurde die Diskussion von der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages und ehemaligen Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn. Sie war federführend an der Entwicklung und Einführung der Exzellenzinitiative beteiligt. In ihrem Impulsvortrag betonte sie vor den rund 150 Zuhörern, dass es die Idee der Initiative war, etwa die Exzellenz, die Kreativität und die internationale Sichtbarkeit der deutschen Universitäten zu stärken.
„Hochschulen bilden das Rückgrat des deutschen Wissenschafts- und Forschungssystems“, sagt Bulmahn. „Doch in den 90er Jahren drohten sie zurückzufallen.“ Das sei mit der Exzellenzinitiative abgewendet worden. „Sie hat frischen Wind und eine dynamische Entwicklung in die Hochschulen gebracht.“ Im Ausland und in der deutschen Öffentlichkeit würden die Unis mit ihren Forschungsleistungen heute eine andere Wertschätzung genießen. Die Initiative habe zur Profilbildung und zur Stärkung der Leistungsfähigkeit der deutschen Hochschulforschung beigetragen. Sie habe zudem zur Entwicklung und Erprobung neuer Governance-Strukturen geführt.
Steffen Krach, Staatssekretär für Wissenschaft in Berlin
Video: Computer- und Medienservice der Humboldt-Universität zu Berlin
Dass das deutsche Wissenschaftssystem mit der Exzellenzinitiative eine Sichtbarkeit erlangt hat, die es Jahrzehnte zuvor nicht kannte, meinte auch Steffen Krach, Staatssekretär für Wissenschaft in Berlin. Er erinnerte daran, dass die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz Ende 2014 zwar beschlossen hat, die Exzellenzinitiative nach 2017 fortzusetzen. In welcher Form das sein wird, könne aber frühestens März 2016 beschlossen werden. Es bleibe also Zeit, um die Ausgestaltung zu diskutieren.
Das ließ sich das Podium nicht nehmen. Das Verhältnis von Breiten- und Spitzenforschung war dabei ein zentrales Thema. Dass die Hochschulen beides brauchen, war einhellige Meinung. „Doch beides braucht eigene Instrumente“, sagte Bulmahn. Die Förderung der Breitenforschung könne nicht die Aufgabe der Drittmittelförderung - also der Exzellenzinitiative - sein. Deshalb müsse die dauerhafte Grundfinanzierung der Hochschulen dringend verbessert werden. Nach der Änderung des Grundgesetzes habe der Bund jetzt die einmalige Chance, einen Teil der Grundfinanzierung der Hochschulen zu übernehmen. Er könne die Länder beispielsweise an den Mehrwertsteuereinnahmen beteiligen oder Studienabschlussprämien zahlen. „Eine vernünftige Balance zwischen der Grund- und der Drittmittelfinanzierung ist mit der Exzellenzinitiative nicht einhergegangen“, sagte Bulmahn. „Das muss jetzt noch angegangen werden.“
Fotos: Mark Wagner
Für Axel Freimuth, den Präsidenten der Universität zu Köln, hat die Exzellenzinitiative die Sichtbarkeit und Reputation der Universitäten hervorgehoben und das Fakultätsdenken aufgebrochen. „Plötzlich wurde über ein gemeinsames Profil einer Universität gesprochen, eine Corporate Identity ist entstanden“, meinte er. Das sei ein großer Vorteil der Initiative gewesen. Das hielt auch Peter Strohschneider, der Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), für einen wichtigen Aspekt. „Wissenschaftler gehören immer einer Fakultät und einer Institution an“, sagte er. „In Deutschland gibt es für sie eine hohe Disziplinen-Loyalität.“ Die Exzellenzinitiative habe es geschafft, einen wichtigen Diskurs in Gang zu setzen – den über das Selbstverständnis einer Universität als Ganzes.
Dass auch die Governance der Universitäten durch die Exzellenzinitiative professionalisiert wurde, betonte Jan-Hendrik Olbertz. Damit entstehe zwar zugleich ein Konfliktpotenzial. Eine solche Dynamik könne man nicht immer steuern. Doch sei diese Entwicklung ein unverzichtbarer Teil der Initiative, der auch künftig in Form der Zukunftskonzepte beibehalten werden müsse.
Da war Christian Thomsen, der Präsident der Technischen Universität Berlin, anderer Meinung. Die Governance gehöre zur Grundstruktur einer Universität, nicht in ein Projekt wie die Exzellenzinitiative. Inge Paulini, Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der HU, meinte dazu, dass die Exzellenzinitiative ein Aufbruch in einem System war, das nicht viel Außenkontrolle hatte. „Über die Vorgaben wurde dann Zwang auf die Strukturen ausgeübt.“
Dass sich die Chancen für den wissenschaftlichen Nachwuchs künftig noch deutlich verbessern müssen, war Konsens unter allen Beteiligten. Für die Zukunft der Exzellenzinitiative waren sich die Diskutanten auch einig darüber, dass die Unis die Zentren des Wettbewerbs bleiben und das Verfahren wissenschaftsgeleitet sein sollte. „Und wir müssen fragen, wie die frühestmögliche Teilhabe der Studierenden an exzellenter Forschung gewährleistet wird“, ergänzte Olbertz. Darüber hinaus fehlte der Exzellenzinitiative aus seiner Sicht eine Idee, wie die einzelnen Projekte nach dem Auslaufen der Förderphase verstetigt werden könnten. Da müsse dringend nachgebessert werden.
Die Exzellenzinitiative konnte und kann nicht alle Probleme des deutschen Wissenschaftssystems lösen, war sich das Podium einig. Sie ist Baustein eines Gesamtkonzepts. „Wir können nicht alle Ziele gleichzeitig mit einem Instrument erreichen“, fasste Bulmahn diesen Punkt zusammen. Doch die Diskussion über die verschiedenen Instrumente ist jetzt in Fahrt gekommen.
Autor des Textes: Roland Koch
Kontakt
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Humboldt-Universität zu Berlin
Tel.: 030 2093-2345
pr@hu-berlin.de