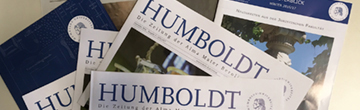„In Bereiche gehen, von denen man nichts versteht“

All diese Themen erscheinen zunächst grundverschieden. Bei einem genaueren Blick treten zudem viele unterschiedliche Teilbereiche zutage. An diesem Punkt lassen sich Zusammenhänge erkennen. Wenn Sie als Wissenschaftler komplexe Systeme untersuchen, finden Sie Gemeinsamkeiten: Phänomene die sich in der Physik, Biologie, Ökonomie oder in den Gesellschaftswissenschaften beobachten lassen. Über die Grenzen wissenschaftlicher Fächer hinweg lassen sich daraus Gesetzmäßigkeiten ableiten. Wer also etwa verstanden hat, was ökologische Systeme so stabil macht, kann auch ein anderes System besser verstehen, zum Beispiel Krisen in der Finanzwirtschaft.
Was lässt sich aus der Ökologie für die Finanzwirtschaft lernen?
Seit der Finanzkrise 2008 ist klar, dass die traditionellen ökonomischen Modelle weder erklären noch vorhersagen können, wann ein System kollabiert. Seitdem hat sich der wissenschaftliche Blick von der Ökonomie auf Konzepte aus der Ökologie und Netzwerktheorie erweitert. Begriffe wie Kipppunkte, Multistabilität und Robustheit gegenüber Störungen wurden in die Wirtschaftswissenschaften eingeführt. Man untersuchte unter anderem das Netzwerk von 5.000 einzelnen Banken, mit Links des Netzwerks für den Transfer von Geldern zwischen einzelnen Banken: Große Banken mit vielen Verbindungen waren typischerweise mit kleineren Banken verbunden, die weniger Verbindungen hatten. Ganz ähnliche Netzwerkstrukturen findet man in symbiotischen Netzwerken, die aus Blütenpflanzen und bestäubenden Insekten gebildet werden. Von diesen ökologischen Netzwerken ist bekannt: Belastet man die Netzwerke zu stark, erreichen sie einen Kipppunkt und kollabieren irreversibel. Aus dieser Einsicht kann man schließen, dass Finanzmärkte zwar prinzipiell schon eine Struktur besitzen, die das systemische Risiko klein hält, aber dennoch durch graduelle Änderungen, wie zum Beispiel andauerndes Wachstum, immer wieder Kipppunkte erreichen, kollabieren und weltweite Finanzkrisen auslösen werden.
Ist das noch interdisziplinäre Forschung – oder schon einen Schritt weiter?
Komplexitätstheorie ist transdisziplinär. Es geht nicht bloß darum, zwischen zwei abgegrenzten Disziplinen eine Brücke zu schlagen, sondern den Blick generell zu weiten. Mit der Zuordnung von Erkenntnissen nach separaten Bereichen gewinnt man wenig. Im Vordergrund, stehen bestimmte Fragen, egal, wo sie inhaltlich verortet sind. Die Fragen bestimmen die Methoden, und nicht umgekehrt. Die großen Krisen, mit denen wir als Menschen konfrontiert sind – Pandemien, globale Konflikte, Klimakatastrophe etc. – hängen miteinander zusammen. Da wird es notwendig, auch einmal in Bereiche zu gehen, von denen man nichts versteht. Dort eröffnen sich neue Perspektiven. Verzerrungen der Wahrnehmung, die dadurch entstehen, dass man sich nur mit einem Thema beschäftigt, lassen sich eher vermeiden, weil man aus Routinen herauskommt. Wissenschaft beginnt buchstäblich ja mit dem Zustand des Unwissens: Wissen schaffen!
Welche Rolle spielen dabei Spezialisten in ihren inhaltlich klar umrissenen Disziplinen?
Hochspezialisierte Experten bleiben wichtig. Doch es braucht auch den Blick über inhaltliche Grenzen hinaus. Virologische Expertise etwa spielt bei der aktuellen Pandemie eine zentrale Rolle. Aber die Dynamik der Pandemie wird in erster Linie durch menschliches Verhalten beeinflusst, unsere Kontaktnetzwerke, unsere Risikowahrnehmung etc. Warum schlagen Corona-Leugner und Impfskeptiker Alarm, wieso entstehen diese Phänomene? Hierfür bedarf es gesellschaftswissenschaftlicher Expertise über Meinungsbildung. All diese Aspekte zusammen betrachtet ergeben ein komplexes System. Um dies zu verstehen, muss Wissen aus unterschiedlichen Bereichen integrativ analysiert werden. Es geht nicht nur um Fakten, sondern um Prozesse. Es kommt darauf an, systemische Strukturen zu erkennen, die hierbei übergreifend wirken.
Ihr Buch erklärt Laien die Grundlagen der Komplexitätstheorie auf unterhaltsame Art. Aber Sie verbinden damit auch ein ernstes und dringendes Anliegen: Sind wir noch zu retten?
Ich habe theoretische Physik und Mathematik studiert und früh mit komplexen Phänomenen außerhalb der traditionellen Grenzen der Physik beschäftigt. Besonders interessieren mich Strukturen und Prozesse in komplexen biologischen und sozialen Netzwerken. Darüber lehre ich am Institut für Biologie. Meine Vorlesung über komplexe Systeme war zunächst eine Herausforderung, weil das für die Studierenden Neuland darstellt. So entstand die erste Idee, dieses abstrakt erscheinende Thema einmal griffig zusammenzufassen. Darüber hinaus wird das Bewusstsein für komplexe Systeme aber für alle wichtig. Stichwort Klimakatastrophe: Das ist ein komplexer, von uns Menschen initiierter Prozess, der das Überleben unserer Art bedroht – und mit weiteren komplexen Krisen zusammenhängt. Wenn wir bei alldem die Kurve kriegen wollen, müssen wir uns beeilen. Und funktionieren kann es nur, wenn wir verstehen, wie diese komplexe Welt funktioniert. Deshalb ist Komplexitätswissenschaft gerade jetzt so wichtig und geht uns alle etwas an.
Interview: Lars Klaaßen
Prof. Dr. Dirk Brockmann ist am Institut für Biologie der Humboldt-Universität Berlin und am und am Robert Koch-Institut tätig. Sein Buch „Im Wald vor lauter Bäumen. Unsere komplexe Welt besser verstehen“ ist ab 17. September 2021 erhältlich (dtv, 240 Seiten, 22,- €).