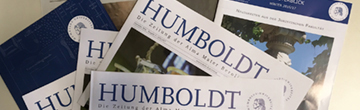„Wir müssen genau überlegen, was wir verantworten können“

Michael Pauen
Herr Pauen, treffen Sie sich gerade freiwillig mit mir?
Aber ja.
Sie treffen Ihre Entscheidungen also autonom?
Meist schon. Aber man kann sich da natürlich nicht immer sicher sein. Es gibt viele Faktoren, die das eigene Handeln bestimmen und die uns nicht immer bewusst sind. Einflüsse durch Werbung etwa oder durch das Verhalten anderer Menschen. Daher denken wir häufig, wir hätten selbstbestimmt gehandelt, aber letztlich ist das gar nicht so.
Heißt das, wir gaukeln uns selbstbestimmtes Handeln nur vor?
So absolut kann man das nicht sagen. Aber es passiert uns natürlich, dass wir meinen, autonom zu handeln, obwohl es gar nicht so ist. Wir fantasieren uns dann sogar Erklärungen für unser Handeln zusammen. Es gibt beispielsweise Experimente, in denen die Versuchspersonen durch ganz kurze Impulse, die sie nicht bewusst wahrgenommen haben, dazu aufgefordert wurden, zu lachen. Das haben sie dann irgendwann getan, und als man sie fragte, warum sie lachen, haben sie sich Antworten ausgedacht. Sie haben etwa gesagt: „weil ihr so lustig seid“.
Das ist ja eher erschreckend. Sind wir also willkürlich manipulierbar?
Nein. So schlimm ist es nicht. Die Grenzen von autonomem Handeln sind uns zwar längst nicht immer bewusst. Wir haben aber eine Reihe von Kontrollmöglichkeiten. Angenommen die Kinowerbung könnte Sie wirklich durch versteckte Reize dazu bringen, Eis oder Schokolade zu kaufen. Das würden Sie vielleicht eine Zeit lang tun. Aber irgendwann würden Sie sich doch fragen, warum Sie immer Eis oder Schokolade kaufen, wenn Sie ins Kino gehen.
Als soziale Wesen sind wir aber doch immer anderen Einflüssen ausgesetzt, etwa durch Werbung oder andere Menschen. Wie ist da autonomes Handeln überhaupt möglich?
Das ist gewiss nicht immer einfach zu erkennen. Jeder von uns hat allerdings eine persönliche Identität, persönliche Präferenzen. Die kann man sich in der Regel bewusst machen. Dann vermag man zu unterscheiden, was von einem selbst kommt und was von außen. Ich will aber auch kein Schwarz-Weiß-Bild erzeugen. Autonomie ist sicherlich nicht immer gut und Konformität nicht immer schlecht. Wir sollten uns sehr wohl dessen bewusst sein, dass in vielen Fällen konformes Verhalten wichtig und notwendig für unser Zusammenleben ist. Denken Sie einfach nur an den Straßenverkehr.
Wie viel Freiheit bleibt uns da für unsere Entscheidungen?
Zunächst sollten wir noch eine Definition klären: Autonomie ist nicht gleich Freiheit. Autonomie ist eine Fähigkeit, die es uns je nach den Umständen erlaubt, frei oder selbstbestimmt zu handeln. Sie ist eine Eigenschaft von Personen. Genauso haben wir auch die Fähigkeit, heteronom, also fremdbestimmt, zu handeln. Und nun zu Ihrer Frage: Die Spielräume, in denen wir autonom handeln können, haben sich in unserer modernen individualisierten Gesellschaft immer weiter vergrößert. Denken Sie etwa an mögliche Bildungswege, an die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wo und mit wem man leben will. Seit der Aufklärung haben sich unsere Entscheidungsmöglichkeiten kontinuierlich und massiv ausgeweitet. Wir können sie viel freier nutzen.
Dennoch meinen Sie, die Autonomie verteidigen zu müssen. Das Buch, das Sie gerade gemeinsam mit Ihrem Kollegen Harald Welzer geschrieben haben, trägt das im Titel. Wieso?
Die Errungenschaften der Vergangenheit stehen heute wieder auf dem Spiel. Die Risiken sehen wir heute vor allem in den Entwicklungen der neuen Medien. Was durch das Internet und die neuen sozialen Medien möglich wird, ist nur schwer absehbar. Konzerne wie Google zum Beispiel arbeiten an Projekten, deren Ziel es ist, vorauszusagen, was jemand haben will, bevor diese Person das selber weiß. Damit kann man Menschen natürlich besser beeinflussen, bestimmte Produkte zu kaufen. Die Autonomie der Konsumenten wird damit massiv beeinträchtigt. Es gibt aber noch eine andere Entwicklung, die erst durch die neuen Medien möglich wird. Ich meine die Teilnahme an bestimmten Massenphänomenen. Das massenhafte Mobben einzelner Personen etwa oder Shitstorms. Da besteht für den Einzelnen die Gefahr, übereilt mitzumachen, sich also einer autonomen Entscheidung berauben zu lassen.
Sie meinen, man lässt sich unter Umständen zu etwas hinreißen, das man bei genauerer Überlegung nicht machen würde?
Genau. Zum einen besteht hier die Gefahr, sich übereilt an solchen Aktionen zu beteiligen. Ein Tweet oder eine Mail sind eben schneller geschrieben als ein Brief auf Papier. Das sind Entwicklungen, die unsere Autonomie auf eine neue Weise gefährden. Auf der anderen Seite kann man aber auch selbst zum Opfer von Mobbing oder Shitstorms werden. Denken Sie an einen ehemaligen Bundespräsidenten, der im Übrigen sicher nicht zu meinen politischen Favoriten zählt. Doch er war längst ruiniert, bevor die Justiz die Sache prüfte. Am Ende blieb nicht viel von den Vorwürfen übrig. Doch die sorgfältige juristische Prüfung wird nur zu oft durch eine mediale Aufregung ersetzt. Das kann unsere Gesellschaft tiefgreifend ändern.
Was können wir tun?
Der erste Schritt ist das Bewusstwerden und Reflektieren. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, was mit Hilfe der neuen Medien passieren kann. Wenn uns das Problem bewusst ist, müssen wir uns in einem zweiten Schritt genau überlegen, wie weit wir mitmachen wollen, was wir verantworten können. Harald Welzer und ich wollen aber keinen Kulturpessimismus betreiben. Für uns ist es keine Lösung, sich allem Neuen zu verweigern. Die neuen Techniken haben für uns alle ja auch positive Seiten. Das Internet eröffnet zum Beispiel Zugänge zu Wissen, die es vorher nicht gegeben hat. Wir sollten die Risiken jedoch klar benennen und überlegen, wie man verantwortlich mit den Möglichkeiten umgeht.
Über das Buch
Michael Pauen ist Professor für Philosophie an der Humboldt-Universität sowie Sprecher der Berlin School of Mind and Brain. Zusammen mit Harald Welzer, Professor für Transformationsdesign an der Universität Flensburg, hat er das Buch „Autonomie. Eine Verteidigung“ verfasst.
Kontakt
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Humboldt-Universität zu Berlin
Tel.: 030 2093-2345
pr@hu-berlin.de