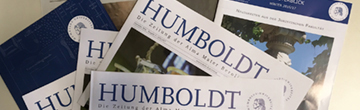„Bei technischen Standards zeigt sich im Kleinen, wie es zu großen geopolitischen Umbrüchen kommt“

Prof. Dr. Sarah Eaton,
Foto: Stefan Klenke
Frau Eaton, Sie haben sich mit Ihrem Forschungsprojekt TECHtonics erfolgreich um einen ERC Consolidator Grant beworben. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch für diese bedeutende Auszeichnung. Um was genau geht es in diesem Projekt?
Prof. Dr. Sarah Eaton: Es geht darum, wie globale technische Standards oder Normen festgesetzt werden und um die Politik, die dahintersteckt. Sie fragen sich vielleicht, was genau das sein soll und was daran wichtig ist. Nehmen wir das Beispiel einer Kreditkarte. Sie muss genau 8,6 Zentimeter breit, 5,4 Zentimeter hoch und 0,8 Millimeter dick sein. Diesem Standard folgen alle Banken auf der ganzen Welt. Und dadurch können wir weltweit Geld abheben – ob in Berlin, Beijing oder Vancouver. Ökonomen bezeichnen das als Interoperabilität – also die Fähigkeit verschiedener Systeme, zusammenzuspielen. Diese Standards werden oft auch als das „stille Fundament der globalen Wirtschaft“ bezeichnet. Sie sorgen für Sicherheit und Verlässlichkeit und sind allgegenwärtig: in den nächsten Generationen von Hochtechnologien zu drahtloser Datenübertragung 5G und 6G oder auch in Regelungen und Vorschriften zu Agrarexporten und Nahrungsmittelsicherheit.
Fünf Jahre lang wird Ihr Projekt nun vom Europäischen Forschungsrat gefördert. Welche Forschungsfragen wollen Sie in dieser Zeit untersuchen?
Eaton: Ich möchte untersuchen, wie sich die Art und Weise, wie Standards ausgehandelt werden, durch das Auftauchen neuer Player verändert. Traditionell wurde das Geschehen lange durch die westliche Welt dominiert. Das hat sich in den vergangenen Jahren stark geändert. China ist in allen möglichen Bereichen, vor allem aber in der Hochtechnologie, sehr ambitioniert beim Setzen neuer technischer Standards. Indien ist ebenfalls auf dem Vormarsch im IT Bereich und auch Kenia hat sich – etwa auf dem Gebiet Waren- und Produktnorme – zu einem wichtigen Akteur entwickelt, der sich dafür einsetzt, dass die Regeln für Länder des globalen Südens fairer werden. Für westliche Akteure sind das teilweise heikle Themen. Denn es gibt die ernstzunehmende Befürchtung, dass neue Regelungen auch für andere Zwecke instrumentalisiert werden könnten. Etwa von der chinesischen Regierung, die sehr eng mit den großen chinesischen Tech-Giganten kooperiert und durch die Hintertür Spionagemöglichkeiten schaffen könnte. China hat sich das klare Ziel gesetzt, eine Standard-Supermacht zu werden. Als Antwort darauf haben die EU und die USA in den vergangenen Jahren eine Kooperation gebildet, um den Einfluss Chinas in sensiblen Hightech-Bereichen zurückzudrängen.
Internationale technische Standards sind also tatsächlich ein hochpolitisches Thema?
Eaton: Ja, absolut. Das erwartet man vielleicht nicht, wenn man das zum ersten Mal hört. Aber wenn ich im Bekannten- oder Familienkreis von 5G, 6G, Huawei und China erzähle, wird die Bedeutung meistens sehr schnell klar. Im Forschungsprojekt wollen wir verstehen, auf welchen Wegen aufstrebende Staaten ihren Einfluss ausbauen, bestehende Barrieren durchbrechen und wie es ihnen gelingt, technische Standards mitzuprägen. Die Entwicklung geht sehr rasant voran und wird durch die gewachsene technische Expertise, aber auch durch neue finanzielle Möglichkeiten angetrieben. Denn die Teilnahme an den Arbeitsgruppen und Gremien, die die Standards beschließen und erarbeiten, ist sehr teuer: Im Bereich Telekommunikation etwa fallen im Komitee pro Jahr und Person rund 300.000 Dollar an – das beinhaltet viele Flüge und Hotelübernachtungen. Auf der anderen Seite schauen wir uns natürlich auch an, was die Konsequenzen daraus sind. Denn es kommt zu Umbrüchen, die sehr komplex sind und viele Facetten haben. Traditionelle, etablierte Rollen und Regeln werden in Frage gestellt. Das Thema erhält zunehmend eine geopolitische Dimension und ist wie ein Mikrokosmos, der im Kleinen zeigt, wodurch große globale Umbrüche angetrieben werden.
Mit welchen Methoden untersuchen sie Ihre Forschungsfragen?
Eaton: Wir planen lange Feldversuche in den drei Ländern China, Indien und Kenia. Dort werden wir qualitative Interviews mit denjenigen führen, die in der Welt der technischen Standards aktiv sind und wir werden auch die entsprechenden Organisationen besuchen. Auch im globalen Norden werden wir mit entscheidenden Akteuren sprechen – etwa in Brüssel, wo sehr viele dieser Fragen verhandelt werden. Außerdem entwickeln wir eine Datenbasis, die die verschiedenen Maßnahmen aufzeigen soll, mit der Teilhabe am Standardisierungprozess ermöglicht wird. Wie viele Anträge dafür landen etwa von welchen Ländern auf dem Tisch und an welche Komitees wenden sie sich? Das gibt uns einen quantitativen Überblick darüber, wie Teilhabe ausgehandelt und geformt wird. Und schließlich wollen wir in Umfragen von IT-Experten in unseren drei Forschungsregionen erfahren, wie sie die Verfahren zur Standardsetzung beurteilen.
Worin sehen Sie die größte Herausforderung bei diesem Vorhaben und was bedeutet der ERC Grant für Ihre Arbeit?
Eaton: Ich bin Expertin für Politik, internationale Beziehungen und Chinastudien. Aber für dieses Projekt muss ich aus meiner Komfortzone heraus und mich mit Ländern vertraut machen, über die ich bisher nicht so viel weiß. Indien und Kenia sind neu für mich – aber das macht alles umso spannender. Ich freue mich sehr, dass ich dank der ERC-Förderung zwei Postdocs und zwei Promovierende für das Projekt einstellen kann. Die finanziellen Ressourcen geben uns einen großen Spielraum, das Thema in aller Tiefe und auch vor Ort zu untersuchen. Das unterstützt meine Arbeit enorm und ist tatsächlich die beste Nachricht des Jahres 2023 für mich gewesen.
Die Fragen stellte Heike Kampe.