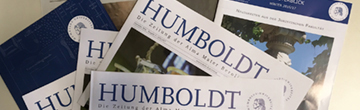Zuhören und mitdenken: Der Podcast „microform“

Redaktion des Podcasts Microform:
Ana María Orjuela-Acosta, Marvin Renfordt, Marie van Bömmel,
Johann Gartlinger (v.l.n.r.). Foto: Morten Schneider
Womit beschäftigt sich der Podcast?
Der Podcast beschäftigt sich mit dem Forschungsfeld der ‚kleinen Formen‘ in Literatur, Wissenschaft und Populärkultur. Diese Formen des Schreibens und Notierens, wie zum Beispiel Tagebücher, Protokolle, Notizen oder Briefe, gewinnen angesichts medialer Mobilitätsschübe und Vernetzungsmöglichkeiten sowie knapper werdender Aufmerksamkeitsressourcen zunehmend an Relevanz. Am Graduiertenkolleg „Literatur- und Wissensgeschichte kleiner Formen“ werden diese Textformen systematisch erforscht. Der Podcast des Graduiertenkollegs versammelt Interviews genauso wie Features über Tagungen sowie moderierte Vortragsmitschnitte und Enzyklopädie-Artikel über ausgewählte ‚kleine Formen‘.
Neben der Wissenschaftskommunikation erfüllt der Podcast für das Graduiertenkolleg die Funktion, Aktivitäten und wissenschaftliche Erträge des Kollegs zu dokumentieren, zu archivieren und öffentlich zu machen. Außerdem schult er die Mitglieder der Redaktion in der auditiven, webbasierten Wissenschaftskommunikation, die den Redakteur*innen innerhalb und außerhalb des Arbeitsfeldes Wissenschaft nützlich sein können.
Wer ist die Zielgruppe?
Der Podcast richtet sich an Forschende der Literatur- und Kulturwissenschaften, aber auch an eine kulturell interessierte nicht-akademische Öffentlichkeit. Die Beiträge erreichen derzeit mehrere hundert Hörer*innen in Berlin und darüber hinaus.
Wer sind die Macher*innen?
Der Podcast wird von Mitgliedern und studentischen Mitarbeiter*innen des Graduiertenkollegs betreut und weiterentwickelt. Das Redaktionsteam setzt sich aus Promovierenden der jeweils aktuellen Generation von Kollegiat*innen zusammen. Derzeit gehören Marie van Bömmel, Johann Gartlinger, Ana María Orjuela-Acosta und Marvin Renfordt der Redaktion an.
Was wird in der aktuellen Folge besprochen?
Im aktuellen Beitrag spricht Kollegiatin Gesche Beyer mit Marie Czarnikow über ihre vor zwei Jahren erschienene Dissertation „Diaristik im Ersten Weltkrieg. Zwischen Alltagspragmatik und Privathistoriographie“. In dem Gespräch geht es um die Frage, warum gerade das ‚kleine‘ Tagebuch zur Form der Stunde erklärt wurde, um den ‚großen‘ Krieg zu dokumentieren. Aber wie gelangten die Tagebuchblätter überhaupt von der Front zu den Angehörigen und dann in die Öffentlichkeit? Und inwieweit wurden die Texte überarbeitet? Im Gespräch über die Vergleichbarkeit von Kriegstagebüchern mit heutigen Formen der Kriegsdokumentation geht es auch um die Besonderheiten des Reenactments von Tagebüchern in Social-Media-Formaten.
Wer moderiert den Podcast? Wer sind die Gäste?
Aufgrund der vielfältigen Formate gibt es keine festen Moderator*innen. Gastgeber*innen sind ein größerer Kreis von Kollegiat*innen – über das Redaktionsteam hinaus. Sie sprechen mit Wissenschaftler*innen aus dem In- und Ausland, mit Mitgliedern des Kollegs, aber auch mit ehemalige Kollegiat*innen.
Wie geht es weiter?
Die nächste Folge erscheint noch im Mai. Darin wird die Kunst- und Kulturwissenschaftlerin Regine Ehleiter von der FU Berlin ihre Forschung zu Ausstellungen vorstellen, die in Form von gedruckten Publikationen erscheinen. Ein rahmender Kommentar von Marie van Bömmel wird durch die Präsentation Ehleiters führen, die wiederum ihre Zuhörer*innen mitnimmt zu ungewöhnlichen Ausstellungsprojekten in Amsterdam und Japan.
In Produktion befindet sich außerdem ein Gespräch mit der Kollegiatin Madeline Zehnder, die über Lektüren im Taschenformat für Soldaten forscht, die im 19. Jahrhundert während des Bürgerkriegs in den USA vertrieben wurden.