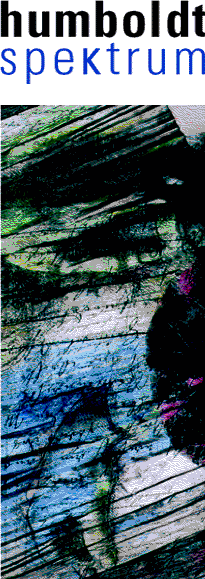Editorial
Spitzenforschung an Universitäten
Das Unmögliche möglich machen
Evelies Mayer
Es mag weltfremd erscheinen, in Zeiten tiefer Haushaltskrisen und
damit verbundener Kürzungen vom Ringen um Spitzenpositionen in
Forschung und Lehre zu sprechen. Der vorliegende Strukturplan der
Humboldt-Universität beinhaltet immerhin die Streichung von 73
Professuren, 136 wissenschaftlichen und 219 sonstigen
Mitarbeiterstellen. Zudem sieht der Haustarifvertrag eine Reduzierung
von Arbeitszeiten um durchschnittlich 10 Prozent vor. Und auch die
Investitionsmittel für den Hochschulbau sind derzeit hart umstritten.
Macht es da überhaupt Sinn, nach wissenschaftlicher Exzellenz, nach
Spitzenpositionen in der internationalen Forschung zu streben? Darauf
kann es nur eine Antwort geben: Natürlich macht es Sinn! Denn ohne
dieses Streben wären der wissenschaftlichen Leistung einer
Universität äußerst enge Grenzen gesetzt. Wissenschaftliche
Exzellenz kennt keine Kompromisse und auch keine Rücksichtnahme auf
komplizierte Rahmenbedingungen. Sie muss sich im harten Wettbewerb und
anhand strenger Kriterien immer wieder neu beweisen. Vor allem jedoch
ist sie an die Kreativität der Menschen gebunden, die sie
hervorbringen.
Die Ausgestaltung des verabschiedeten Strukturplans wird die
Humboldt-Universität in den nächsten Jahren vor große
Herausforderungen stellen. Wenn die Humboldt-Universität in der
Forschung internationale Standards halten oder erreichen will, wenn sie
national und international sichtbar und für Nachwuchswissen-
schaftler, Studierende wie Drittmittelgeber attraktiv sein will,
müssen die vorhandenen Ressourcen noch stärker als bisher auf
Schwerpunkte konzentriert werden. Mit ihren Bemühungen um die
Einrichtung Interdisziplinärer Zentren ist die Humboldt-Universität
bereits auf einem guten Weg: Zentren bieten eine hervorragende
Möglichkeit, vorhandene Kräfte über Fächergrenzen hinweg zu
bündeln und dies nicht nur innerhalb der Humboldt-Universität,
sondern auch mit anderen Universitäten, mit anderen
Forschungsein-
richtungen, mit Museen, mit der Wirtschaft und anderen Partnern. Die
zeitliche Befristung der Zentren macht zugleich ein flexibles Reagieren
auf Forschungsent-
wicklungen möglich.
Neben den bereits bestehenden vier Interdisziplinären Zentren
existieren derzeit 14 Initiativen, von denen allein vier im Bereich der
Lebenswissenschaften an-
gesiedelt sind. Für einen Schwerpunkt "Lebenswissen-
schaften" bietet die Forschungslandschaft Berlin-Bran-
denburg beste Voraussetzungen. Hier eröffnet sich ein
aussichtsreiches Feld der Zusammenarbeit von Na-
turwissenschaften, Medizin und Sozialwissenschaften und damit zugleich
eine ?Brücke? zur Charité.
Doch die erfolgreiche Etablierung von Zentren bedarf nicht nur guter
Worte und bester Absichten, sie muss auch materiell unterstützt
werden. Deswegen plädiert das Kuratorium für eine deutliche
Aufstockung des Innovationsfonds, was bedeutet, dass jeder im Interesse
des Ganzen etwas von dem abgeben muss, was ihm - nach Kürzung der
Landeszuschüsse - noch zur Verfügung steht. Uns ist klar, dass wir
damit viel von den Fakultäten und Instituten verlangen. Doch die
Zentrenbildung wird nicht zuletzt dazu beitragen, die
Humboldt-Universität im Wettbewerb um zusätzliche Mittel zu stärken.
Gerade mit Blick auf den Wettbewerb um Spitzenuniversitäten,
Exzellenzcluster und Graduiertenkollegs bieten Interdisziplinäre
Zentren beste Voraussetzungen. Doch es gibt dabei noch eine große
Hürde: Selbst exzellente Universitäten und Cluster können sich nur
dann am Wettbewerb beteiligen, wenn das Land bereit und in der Lage
ist, zur Fördersumme 25 Prozent beizusteuern. Hierfür wird wohl ein
Sonderprogramm des Landes Berlin nötig sein, denn der gebeutelte
Hochschuletat des Wissenschaftssenators gibt die erforderliche
Kofinanzierung nicht mehr her. Jetzt muss der Senat von Berlin
beweisen, was ihm Spitzenpositionen in der Forschung wirklich wert
sind. Die Humboldt-Universität wird jedenfalls durch eine Bündelung
exzellenter Forschung zeigen, dass es sich lohnt, in Wissenschaft zu
investieren.
|
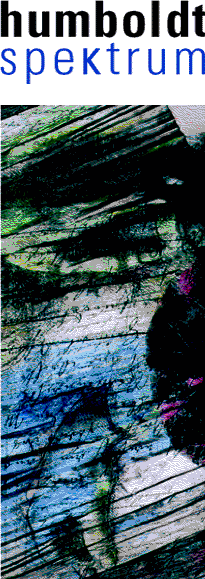
|