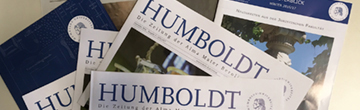Umgezogen ins Intranet
Liebe Humboldtianer:innen, die von Ihnen gesuchten Inhalte sind in das Intranet Humboldt Intern umgezogen. Aber: Das Intranet erreichen Sie mit nur einem Klick, schauen Sie vorbei:
Schnellzugriffe
Kontakt & Support
Bei allgemeinen Fragen rund um das Intranet:
interne-kommunikation@hu-berlin.de
Bei Problemen mit dem Zugang zum Intranet:
interne-kommunikation@hu-berlin.de
Zu Inhalten der Abteilung Personal & Personalentwicklung:
Kaj Schumann
kaj.schumann@hu-berlin.de