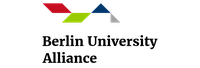Themen
bua_protokolle_campus_nord_Bharath_Ananthasubramaniam_23.01.2024_stefan_klenke__10.1.2024_fotograf_stefan_klenke-431067_1920px_Kopie.jpeg
bua_protokolle_campus_nord_Bharath_Ananthasubramaniam_23.01.2024_stefan_klenke__10.1.2024_fotograf_stefan_klenke-431067_1920px_Kopie.jpeg
bua_protokolle_campus_nord_Bharath_Ananthasubramaniam_23.01.2024_stefan_klenke__10.1.2024_fotograf_stefan_klenke-431067_1920px_Kopie.jpg
bua_protokolle_campus_nord_Bharath_Ananthasubramaniam_23.01.2024_stefan_klenke__10.1.2024_fotograf_stefan_klenke-431067_1920px_Kopie.jpg
bua_protokolle_campus_nord_Bharath_Ananthasubramaniam_23.01.2024_stefan_klenke__10.1.2024_fotograf_stefan_klenke-431193_1920px.jpg
christian_stein_interview_BUA_matters_of_activity_7.2.2024_stefan_klenke-713390-1.png
christian_stein_interview_BUA_matters_of_activity_7.2.2024_stefan_klenke-713606.jpg
web_#WirSindBUA_20250115_prof_dr_aileen_edele_04.12.2024_stefan_klenke-0346-edit.jpg
HU Berlin Academic Freedom Week
Between Precarity and Agency – Being an academic at risk
At the Berlin Academic Freedom Week 2025 at Humboldt-Universität zu Berlin, President Julia von Blumenthal announced the keynote speaker Prof. Nazan Maksudyan in the Senatssaal on April 2, 2025 in her welcoming address:
Dear Prof. Maksudyan, (Keynote speaker)
Distinguished guests,
Ladies and Gentlemen,
Good afternoon. It is a great pleasure to welcome you to the final event of the third Academic Freedom Week at Humboldt-Universität. When we started this series of events, we were worried by the situation of scholars in authoritarian regimes orin the situation of war and violent conflict. We did not envision what we are seeing today, that Academic Freedom is under threat worldwide. The latest Academic Freedom Index sheds light on the fact that even democracies are not immune against threats to academic freedom. We look at the events unfolding in the United States with deepest concern, where students are arrested under dubious accusations, where world leading universites are struggling with a situation they arenot prepared for.
The Humboldt-Universität zu Berlin is founded on a deep conviction: the pursuit of knowledge shapes and enriches all human capacities. It is one of the most powerful forces driving the humanization of our societies. Excellence can only thrive with academic freedom.
At the same time, with our long history of research and academic excellence, as Humboldt Universität we are founded on values: we oppose all kinds of discrimination, we oppose antisemitism, authoritarianism, and fanaticism — a lesson from our past that resonates strongly today. These values create individual responsibility for our scholars to reflecton the consequences of their research. In this regard they form a limit for academic freedom that is otherwise without borders.
Our university stands for both, academic / scientific freedom, fundamental values and societal responsibility. At Humboldt-Universität, we are deeply committed to solidarity and support for at risk scholars and students. This commitment is reflected in our active efforts to assist those who face persecution and violence because of their academic work.
Thanks to the outstanding support of the Alexander von Humboldt Foundation’s Philipp Schwartz Initiative and the Einstein Foundation Berlin’s Academic Freedom Fellowship, Humboldt Universität has been able to support more than 60 scholars from 12 countries, including Ukraine, Belarus, Russia, Afghanistan, and Gaza. These researchers, from diverse fields such as philosophy, literature, biology, chemistry, geography, and law, have found a safe environment to continue their work.
Our commitment also extends to at-risk students. Programs like the Refugee Law Clinic and the Welcome Centre for Ukrainian refugee students reflect our dedication to providing support and opportunities. In challenging times like these, collective action is essential. I am delighted that we have brought together such a diverse group of actors at Humboldt-Universität – all working for and with at-risk researchers and artists.
This year’s Academic Freedom Week bridges regional and international perspectives. It brings together at-risk scholars from Berlin and Brandenburg with colleagues and mentors from local universities. None of this would have been possible without the invaluable contributions of our at-risk Fellows from HU, Europa-Universität Viadrina, and Kunsthochschule Weissensee. We also extend our gratitude to our colleagues and partners from the Berlin Centre for Global Engagement, Universität der Künste, and the Einstein Foundation Berlin.
We are also honored to welcome our international guests: the New University in Exile Consortium. This initiative continues the legacy of theNew School, founded in 1933 by Alvin Johnson to offer a safe intellectual home to scholars fleeing the rise of Nazism in Europe.
In coming days, we will host the Philipp Schwartz Initiative Forum, that has been turning Berlin into a stage for academic freedom from March 31st until April 4th. Together, we will explore what academic solidarity looks like in a world where even global solidarity itself is under threat. The gathering of local and international actors during this Academic Freedom Week offers one possible answer. I am confident that the Forum will provide many more.
Let me conclude: the fact, that even in established democracies academic freedom is not unchallenged remind us of the need for vigilance and solidarity in protecting the principles that underpin our academic communities. We need academic freedom, we need a deep understanding in the political sphere how important academic freedom is for the development of science, education and our societies as a whole. We as universites bear responsibility for the defense of academic freedom and for the defense of thefundamental values we stand for. For today’s challenges it is good to look back in history. To see, what we can learn.
Dear Prof Maksudyan, you will now talk about the experiences of German-Jewish refugee scholars in Turkey during the 1930s and 40s.
I am very much looking foward to this keynote and thank everyone involved in the 2025 Academic Freedom Week.
Prof. Maksudyan, the floor is yours.
Hochschulautonomie: im Grundgesetz verankertes Selbstbewusstsein
Nicht nur einzelne Forschende, sondern auch die öffentlichen Hochschulen können sich auf die Freiheit der Wissenschaft aus Art. 5 Abs. 3 GG berufen. Das ist nicht selbstverständlich, schließlich werden diese vom Staat gegründet und finanziert. Doch wurde die Berechtigung der Hochschulen im Grundsatz schon in der Weimarer Zeit anerkannt und früh vom Bundesverfassungsgericht bestätigt. In Deutschland wird damit eine alte Geschichte fortgeschrieben, in der Hochschulen immer wieder in Konflikt mit der politischen Gewalt kamen und auf ihren Status als eigene Körperschaft pochten.
Hochschulautonomie als Voraussetzung
Der heute geltende Schutz der Wissenschaftsfreiheit garantiert zunächst, dass die Hochschulen alle Fragen von Forschung und Lehre eigenständig entscheiden können. Damit ist namentlich eine organisatorische Selbstständigkeit verbunden, die auch als Hochschulautonomie bezeichnet wird. Der Gesetzgeber kann zwar Universitäten gründen und ihre Form in Grundzügen ausgestalten, es muss aber dabei bleiben, dass die Universität von Wissenschaftler*innen für Wissenschaftler*innen organisiert und verwaltet wird.
Das wirft natürlich die Frage auf, wer sich innerhalb der Hochschule auf die Wissenschaftsfreiheit berufen kann: Präsidien, Professor*innen, PostDocs, Doktorierende oder Studierende? Grundsätzlich muss die Berechtigung bei denen liegen, die Wissenschaft betreiben. Das sind aber, anders als es früher auch vom Bundesverfassungsgericht angenommen wurde, nicht nur die Professor*innen, sondern all diejenigen, die forschen, und auch die Institutionen, die die Forschenden vertreten und für sie handeln.
Selbstverwaltung und Mitbestimmung
Aus der Hochschulautonomie folgt damit intern auch ein Recht auf Selbstverwaltung. Forschende haben das Recht (und die Pflicht) darüber zu entscheiden, wer in der Universität ein Amt bekommt. Doch besteht die Hochschule nicht nur aus Forschenden, sondern hängt auch von vielen anderen Mitarbeitenden, den Beschäftigten in der Verwaltung, ab. Auch sie haben Mitbestimmungsrechte – und zugleich muss der Grundsatz beachtet werden, dass über wissenschaftliche Fragen wie Forschungsinhalte oder Berufungen von Forschenden entschieden wird.
Die Verwaltung ist wichtig, aber sie dient der Wissenschaft. Das macht die gelebte Wissenschaftsfreiheit zu einer komplizierten Praxis, in der sich selten grundrechtliche Freiheit und Staat direkt gegenüberstehen, viel öfter dagegen verschiedene Wissenschaftsfreiheiten, die gegeneinander abgewogen und miteinander ausgehandelt werden müssen.
Politische Einflussnahme statt direkter Zensur
Die grundgesetzliche Wissenschaftsfreiheit der Hochschulen ist in Deutschland – bis auf weiteres – nicht dadurch gefährdet, dass der Staat Forschungsfragen vorschreibt und mit Sanktionen droht. Öfter wurde sie dadurch infrage gestellt, dass er seine Vorstellung einer richtigen, sei es demokratischen, sei es politischen Organisation durchsetzen wollte, etwa indem er Nichtforschende wie Wirtschaftsvertreter in Hochschulgremien setzten wollte. In solchen Fällen hat das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber nicht selten daran erinnert, dass Hochschulen keine Unternehmen und auch keine Verwaltungen sind.
Überhaupt ist die Wissenschaftsfreiheit ein oft bemühtes Grundrecht. Es gibt vergleichsweise viele Entscheidungen zum Hochschulrecht von Verfassungs- und Verwaltungsgerichten. Die Wissenschaftsfreiheit ist auch rechtswissenschaftlich besser aufgearbeitet als viele andere Grundrechte. Das dokumentiert das Selbstbewusstsein der Hochschulen gegenüber dem politischen Prozess.
Selbstbewusste Hochschulen und das Recht
Eine allgemeine politische Neutralitätspflicht der Hochschulen gibt es nicht. Neutralität ist heute oft ein Argument, um dissentierende Institutionen aus der öffentlichen Auseinandersetzung zu nehmen. Doch kennt das Hochschulrecht zwei Sonderregeln: Zum einen haben die Studierendenvertretungen kein „allgemein-politisches“ Mandat. Sie dürfen sich nicht zu allen möglichen politischen Fragen in ihrer Vertretung äußern, sondern nur zu Angelegenheiten der Hochschule. Das wird vom Gesetzgeber damit gerechtfertigt, dass alle Studierenden Mitglied der Vertretungen sein müssen. Zwingend erscheint es nicht. Zweitens kennt das Grundgesetz in Art. 5 Abs. 3 Satz 2 GG eine Ausnahme von der Lehrfreiheit (nicht von der Forschungsfreiheit) mit Blick auf die Verfassungstreue. Professor*innen dürfen nicht im Namen der Wissenschaft gegen den demokratischen Rechtsstaat hetzen.
Nicht gegen alle Bedrohungen der Wissenschaftsfreiheit hilft ein Grundrecht. Insbesondere garantiert Art. 5 Abs. 3 GG keine feste Finanzierung der Hochschulen, es schützt sie auch nicht unbedingt vor einer Schließung. Durch die Drohung mit Mittelkürzungen hat der politische Prozess ein informelles Instrument in der Hand, das auch dazu genutzt werden könnte, unliebsame Forschung zu verhindern. In den USA ist dies zu beobachten, aber auch in Deutschland zeigten sich Ansätze in diese Richtung, etwa in den umstrittenen Äußerungen der letzten Bundesforschungsministerin. Die Hochschulen sollten sich, soweit möglich, gegen solche Anmutungen auf ihr Grundrecht berufen und gerichtlich zur Wehr setzen, aber das wird, wenn es hart auf hart kommt, nicht reichen. Dann ist politisches Handeln und Solidarität des ganzen Wissenschaftssystems gefragt.
Christoph Möllers ist Professor für Öffentliches Recht, insb. Verfassungsrecht, und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin und Principal Investigator im Exzellenzcluster SCRIPTS
Material, das durch die Hände rinnt
Im Exzellenzcluster „Matters of Activity“ forschen Wissenschaftler*innen zu den Materialien der Gegenwart und der Zukunft. Die Forscherinnen Léa Perraudin und Iva Rešetar beschäftigen sich mit Paraffin, einem sehr veränderlichen Material, das ökologische und geopolitische Fragen aufwirft.
Das Projekt „Latent Accumulations“ des Exzellenzclusters „Matters of Activity“ befasst sich mit Paraffin, einem schwer greifbaren Material – von seinem Anschwemmen an der Ostseeküste der Kurischen Nehrung in Litauen bis hin zu dringenden ökologischen und geopolitischen Fragen.
Ähnlich wie Bernstein, aber doch in anderer Größe und Anzahl liegen sie am Strand der Kurischen Nehrung in Litauen: grau-weiße oder gelb-bräunliche wächserne Brocken, mal größer, mal kleiner, unscheinbar und entfernt nach Erdöl riechend: „Das Paraffin ist den Einwirkungen der Umwelt ständig ausgesetzt. Es wird durch Kälte geformt oder von Hitze verflüssigt und mit Sand vermischt“, sagt Iva Rešetar, Wissenschaftlerin im Exzellenzcluster „Matters of Activity“. Nicht nur die Veränderlichkeit des Materials selbst, auch seine Verbreitung in der Landschaft und Verschmutzung der Strände, insbesondere im Zusammenhang mit umliegenden Ölinfrastrukturen, interessiert die Architektin.

Die Wissenschaftlerinnen Iva Rešetar und Léa Perraudin.
Foto: Stefan Klenke
Das Paraffin ist nie allein und isoliert, lautet eine der Ausgangsthesen des Projekts „Latent Accumulations“. „Es überschreitet die landschaftliche Schwelle zwischen Meer und Strand, die geopolitische Grenze zwischen Litauen und Russland – und es ist entweder plötzlich haufenweise da oder es sammelt sich erst allmählich an“, stellt ihre Projektkollegin, die Medienwissenschaftlerin und Kulturanthropologin Léa Perraudin, fest. Ob und wann das passiert, sei für die Anwohner*innen und Mitarbeitenden des Nationalparks Kurische Nehrung nicht vorhersehbar.
Stoffe im Wechselspiel mit der Umgebung
Für die beiden Wissenschaftlerinnen war der Auslöser für die nähere Befassung mit dem veränderlichen Material eine Einladung ins Werkstoffarchiv der Stiftung Sitterwerk im schweizerischen St. Gallen. Dass dort Materialien wie Paraffin mit jeweils verwandten Stoffen wie Bienenwachs oder Fetten als reine, feste Substanzen ausgestellt werden, „brachte uns dazu, diese Art der Ordnung und Stabilisierung der Dinge zu hinterfragen“, sagt Iva Rešetar. Das Paraffin selbst eignete sich aufgrund seines hybriden, mal flüssigen, mal festen Zustands bestens dazu. In der benachbarten Kunstgießerei hätten sie beide beobachten können, „wie es in einem Prozess ständig geschmolzen, gehärtet und geformt“ und dabei zum Hilfsmaterial künstlerischer Praxis wurde.
Die Forschungen sind in das Exzellenzcluster „Matters of Activity“ eingebettet, dessen Name darauf anspielt, dass sowohl Materialien als auch Angelegenheiten aktiv bzw. veränderlich sind. Normalerweise stünden in der Architektur feste Stoffe wie Stahl oder Beton sowie solide Konstruktionen im Mittelpunkt und nicht ihre Umgebungen, betont Iva Rešetar. Besonders interessant für sie seien jene Stoffe, die ihren Zustand verändern, wie Wachse, die nicht an ein Objekt gebunden sind, aber sich im Wechselspiel mit der Umgebung befinden.
Frage des Naturschutzes besonders dringlich

Paraffin: Veränderliches Material.
Foto: Stefan Klenke
Um sich weiter mit dem synthetischen Paraffin zu beschäftigen, reisten Rešetar und Perraudin im Rahmen einer Forschungsresidenz an der Nida Art Colony der Vilnius Academy of Arts im Januar 2025 erneut auf die Kurische Nehrung. Im Sommer 2024 fuhren sie zu einer ersten Sichtung der Verschmutzung an die langen Strände des UNESCO-Weltkulturerbes.
Das Aufkommen von Paraffin sei auch historisch interessant, sagt Léa Perraudin. Beim Raffinieren von Erdöl entstand das weiß durchscheinende, geruchlose Nebenprodukt in großer Menge – und wurde in der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie sowie in der Medizintechnik eingesetzt. Warum es sich als Abfallstoff in der Baltischen See ablagert, dazu gebe es von Seiten der Forschung und von Umweltinitiativen verschiedene Theorien.
Denn der Ort Nida liegt nahe der Grenze zur russischen Exklave von Kaliningrad – einer nahezu unsichtbaren Grenze mitten im Weltkulturerbe. „Die Frage des Naturschutzes ist hier besonders dringlich“, betont Perraudin. Der einen Theorie nach ist es die Ölplattform, die im russischen Teil der Ostsee liegt und bei ungünstiger Strömung den Strand verschmutzt. Die andere macht die Erdöl-Tanker verantwortlich, die auf offener See verbotenerweise ihre Tanks reinigen, so dass Paraffin-Rückstände ins Wasser gelangen. „Das Material könnte demnach, wenn es sich mit dem kalten Wasser vermischt, vom flüssigen in den festen Zustand übergehen.“
2020 organisierte der Nationalpark die bis dato größte Sammelaktion, bei der die Brocken ganze Container füllten. „Die Menschen waren gezwungen zu handeln“, stellt Iva Rešetar fest. „Wir haben mit den Anwohner*innen, mit Hafenarbeiter*innen und Meeresforscher*innen der Uni Klaipeda gesprochen, um aus verschiedenen Perspektiven ein Bild der Paraffinverschmutzung zu zeichnen.“ Die Forscherinnen wollen allerdings keine wissenschaftlichen Fakten liefern, sondern haben eigene Methoden entwickelt, um dem schwer greifbaren Material näher zu kommen.
„Material irreversibel mit der Umgebung vermischt“
„Bei unseren gemeinsamen Spaziergängen mit Menschen, die den Ort gut kennen oder von außerhalb kommen, kommen wir darüber ins Gespräch, welche Erinnerungen sie mit dem Paraffin verknüpfen“, berichtet Léa Perraudin. „Hier stellen wir immer wieder fest, dass es direkten Austausch mit Menschen aus der Zivilgesellschaft vor Ort braucht, um dringende ökologische und soziale Fragen gemeinsam zu verhandeln.“

Das Projekt „Latent Accumulations“ des Exzellenzclusters
„Matters of Activity“ befasst sich mit Paraffin.
Foto: Anna Luise Schubert
Aus anthropologischer Perspektive ließen sich verschiedene Dynamiken beobachten, wie unterschiedlich Menschen mit dem Material und der Unklarheit umgehen, woher es kommt. Eine Frau, die auf der Kurischen Nehrung aufgewachsen war, habe beispielsweise erzählt, dass sie in ihrer Kindheit dort öfters mit der Familie auf Strandurlaub war. „Sie war überrascht. Den Geruch des in der Sonne erwärmten Paraffins schrieb sie eigentlich dem Strand zu“, so die Wissenschaftlerin. „Das Material ist also irreversibel mit der Umgebung vermischt und schreibt sich in die Erinnerung ein.“
Das Projekt zielt auch darauf zu kritisieren, wie Menschen die natürlichen Ressourcen ausbeuten, in verschiedene Bestandteile trennen und diese teilweise wieder als Müll oder Chemikalie an die Umwelt zurückgeben – mit allen Folgen für die umliegenden Gemeinden und die Menschen. „Es werden aus der Erde mit größter Selbstverständlichkeit Erdöl und Mineralien extrahiert, die für unsere technologische Kultur benötigt werden“, sagt Perraudin. Die Kulturanthropologin rechnet sich einem jüngeren Forschungsfeld der „Environmental Humanities“ zu, die diese konfliktbehaftete Beziehung in den Vordergrund rücken und mit kritischen Methoden wie feministischen und dekolonialen Theorien verbinden. „Ich möchte wissen, was passiert, wenn uns veränderliche Materialien durch die Hände gleiten. Das ist kein neutraler Prozess, sondern eine öffentliche Angelegenheit.“
„Jede Putzaktion der Tanker provoziert eine Putzaktion am Strand“
Paraffin gilt in fester Form als Meeresmüll, in flüssiger als chemische Kontamination – und unterliegt somit unterschiedlichen gesetzlichen Bestimmungen. Dass es vom physischen Zustand abhängt, wie man mit Material umgeht, sei frappierend. Das Projekt trage dazu bei, Gespräche über die ökologische Krise oder die Art und Weise anzustoßen, wie die Menschen zusammenleben wollen.
Mittlerweile sei die baltische Küste weniger durch Paraffin verschmutzt und das Bewusstsein für das Problem größer geworden, ergänzt Iva Rešetar. Strengere Gesetze seien dennoch wichtig, damit Schiffe das verschmutzte Abwasser nicht mehr ins Meer verklappen. „Jede Putzaktion der Tanker provoziert später eine Putzaktion am Strand.“ Eine nicht endende Aktivität, werden die Brocken doch wieder und wieder dort angespült. Wann genau, das wissen die Menschen vor Ort nicht. „Im Zentrum unserer kollaborativen Methoden stehen deshalb Fragen zu anderen Möglichkeiten der Pflege und Erhaltung von fragilen Landschaften.“
Über die Wissenschaftlerinnen
Iva Rešetar ist Architektin und interdisziplinäre Forscherin am Exzellenzcluster "Matters of Activity" der HU Berlin, wo sie die Schnittstellen von Architektur mit Umgebungs- und Klimafragen untersucht. Besonderes Interesse sind fluide und marginalisierte Materialien. Ihre Forschung befasst sich mit historischem und experimentellem Wissen von thermodynamischen Prozessen wie Wärme und Phasenübergänge im Design und deren Auswirkungen auf kollaborative Reparaturpraktiken in der heutigen Klimakrise.
Léa Perraudin forscht am Exzellenzcluster »Matters of Activity« der HU Berlin und ist Projektleitung des Experimentallabors »CollActive Materials« (gefördert von der BUA, 2022-2025). Schwerpunkte in Forschung und Lehre liegen im Feld der Environmental Media Studies und der queer-feministischen Science and Technology Studies. Ein besonderes Anliegen gilt neuen Formen der Kollaboration zwischen kritischer Forschung und materiellen Alltagspraktiken angesichts aktueller ökologischer und geopolitischer Herausforderungen.
Sonderausstellung im Tieranatomischen Theater
Vom 9. bis 31. Mai ist eine Sonderausstellung innerhalb der Ausstellung „muddy measures. When wetlands and heritage converse“ des Centre for Advanced Studies inherit, heritage in tranformation“ im Tieranatomischen Theater auf dem Campus Nord der Humboldt-Universität zu Berlin zu sehen. Sie ist Teil des _matter Festivals vom Exzellenzcluster „Matters of Activity“.
Weitere Informationen
Zum Artikel auf der MoA-Webseite (englisch)
Autorin: Isabel Fannrich-Lautenschläger
Wissenschafts- in Abgrenzung zu Meinungsfreiheit
Der berufsethische Leitfaden der Humboldt-Universität bietet Orientierung
Die Meinung von Wissenschaftler*innen zu aktuellen Themen ist mehr denn je gefragt. Die Humboldt-Universität zu Berlin (HU) bietet als öffentliche Institution Raum für Diskurs und Debatte. Dabei kann insbesondere bei konfliktbeladenen Themen ein Spannungsfeld von Wissenschaft und Öffentlichkeit bzw. von Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit entstehen. Der Akademische Senat der HU hat im März 2024 einen Leitfaden verabschiedet, um Forschenden im Umgang mit konfliktträchtigen Themen eine Handlungsempfehlung zu geben. Der Professionsethische Leitfaden wurde in zweijähriger Arbeit von Professor*innen, wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen, Studierenden und Mitgliedern der Verwaltung und der Universitätsleitung entwickelt und ist auf große Resonanz in den Medien und in der Hochschullandschaft gestoßen.
Verfassungsrechtlich ist die Wissenschaftsfreiheit ein Grundrecht, das die eigenverantwortliche Tätigkeit in Forschung und Lehre vor wissenschaftsexternen Eingriffen schützt. Träger*innen dieses im Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes fixierten Rechts sind diejenigen, die eigenver- antwortlich wissenschaftlich tätig sind.
Universitätsleitungen werden abgesehen von der in Art. 5 Abs. 3 Satz 2 GG gesetzten Grenze der Verfassungstreue keine Weisungen zur inhaltlichen Ausrichtung oder personellen Besetzung von wissenschaftlichen Veranstaltungen erteilen. Zu ihren Aufgaben gehört es aber, den sicheren Ablauf von Veranstaltungen zu gewährleisten.
Nicht von der Wissenschaftsfreiheit geschützt sind politische Meinungsäußerungen auf dem universitären Campus. Wenn Wissenschaftler*innen zu gesellschaftlichen Debatten außerhalb der eigenen fachlichen Expertise Stellung nehmen, sind ihre Beiträge allein durch die Meinungs- und Redefreiheit geschützt, also durch das ebenfalls grundgesetzlich garantierte „Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten“ (Art. 5 Abs. 1 GG).
Kontroversen über inhaltliche Positionen von Wissenschaftler*innen treten häufig dann auf, wenn nicht klar ist, ob die inkriminierte Stellungnahme durch die Wissenschaftsfreiheit oder durch die Meinungsfreiheit geschützt ist. Zwar scheinen wissenschaftliche Fachdiskussionen hinreichend klar von politischem Meinungsstreit abgrenzbar. Es ist aber im Schnittfeld zwischen Universität und Öffentlichkeit oft herausfordernd, die Unterscheidung zwischen empirischen Daten, Interpretationen der Daten, wissenschaftlich fundierten Schlussfolgerungen und aus transparenten Maßstäben abgeleiteten Bewertungen auf der einen Seite und politischen Meinungen und Handlungsempfehlungen auf der anderen Seite zur Geltung zu bringen. Bloße Meinungsäußerungen und persönliche Wertungen liegen außerhalb des Schutzbereichs nach Erkenntnis suchender Wissenschaft.
Besonders problematisch ist die Berufung auf die Wissenschafts- statt auf die Meinungsfreiheit, wenn nicht von Fakten und Forschungsergebnissen gedeckte Schlussfolgerungen gezogen oder unausgewiesene Wertungen vorgenommen werden, oder wenn Forschungsergebnisse auf eine Weise präsentiert werden, die stillschweigend politische Richtungsentscheidungen vorwegzunehmen sucht. Wissenschaftler*innen müssen in jedem Fall vermeiden, etwas als Ergebnis eigener Forschung, das heißt eines erkenntnissuchenden Vorgangs, darzustellen, was nicht nach den fachlichen Standards einer Fachwissenschaft erarbeitet wurde.
Auszug aus: Professionsethischer Leitfaden "Wissenschaft- und Meinungsfreiheit im öffentlichen Raum"
Der Professionsethische Leitfaden wurde in zweijähriger Arbeit von Professor*innen, wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen, Studierenden und Mitgliedern der Verwaltung und der Universitätsleitung entwickelt.