Humboldt-Spektrum 01/1999
|
Inhalt
|
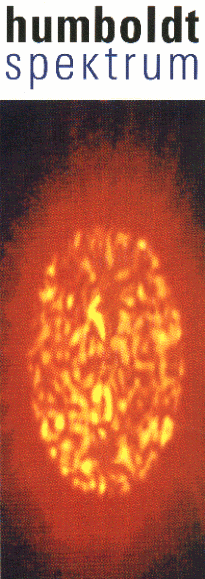 |
- Kontaktadressen der Autoren/Autorinnen des
Hochschulbereiches finden Sie unter:
http://www.hu-berlin.de/zis/Personen/searchform1.php3?langmode=german - Kontaktadressen der Autoren/Autorinnen der Medizinischen
Fakultät Charité finden Sie unter:
http://www.charite.de/org/a2z/
Der genetische Fingerabdruck
Lutz Roewer/Marion Nagy/Gunther
Geserick
Heft 1/99, S. 4-11.
abstract
In einem dünn besiedelten Landstrich Niedersachsens werden mehr
als 12.000 Männer zur Speichelprobe gebeten. Die Polizei steckt mit
ihren Ermittlungen zum Sexualmord an einem Kind in einer Sackgasse und
greift - auch unter dem Druck der Öffentlichkeit - zu dem Mittel des
massenhaften Abgleichs »Genetischer Fingerabdrücke«. Der Vorgang
entfachte eine breite Diskussion, in deren Mittelpunkt Fragen standen
wie: Was ist ein Genetischer Fingerabdruck? Woran lassen sich
menschliche DNS-Moleküle unterscheiden? Sind die
Unterscheidungsmerkmale wirklich persönlichkeitsneutral, so daß sie
für Ermittlungszwecke genutzt werden dürfen? Welcher methodische
Kunstgriff fördert die Variabilität zutage? Wo liegen die
Nachweisgrenzen für die neue Technik? Wie sieht eine Datei mit
genetischen Fingerabdrücken von Straftätern aus? Auf diese und andere
Fragen sowie damit verbundene Forschungsschwerpunkte am Institut für
Rechtsmedizin der Humboldt-Universität zu Berlin geht dieser Beitrag
ein.
University Clinic Charité: Distributed Medical Intelligence - Interactive Stereoscopic Telemedicine
Frank Engel-Murke/Georgi Graschew/Gunter
Bellaire/Stefan Rakowsky/Peter M. Schlag
Heft 1/99, S. 16-22.
abstract
The paper describes the setting up of an interactive, stereoscopic
telemedicine system at the Surgical Research Unit OP 2000,
Robert-Rössle-Klinik am Max-Delbrück-Centrum für molekulare Medizin,
Charité in Berlin, consisting of medical stereoscopic imaging devices,
visualization tools for medical volume data, stereoscopic viewing
facilities and interactive in-house and ex-house stereoscopic and
non-stereoscopic telecommunication possibilities.
Die alten und die neuen Barbaren: Barbarisierung und Entbarbarisierung von Völkern im Diskurs der Humanisten des 15. und 16. Jahrhunderts
Herfried Münkler/Hans Grünberger
Heft 1/99, S. 26-32.
abstract
Seit den Griechen der klassischen Antike dient der Begriff des
Barbaren dazu, Fremdheitsbeziehungen ein kulturelles Gefälle zu
unterlegen. Wo von Barbaren die Rede ist, kann prinzipiell auf
Vorstellungen politischer wie kultureller Gleichheit verzichtet werden.
Man mag die Barbaren ob ihres - eben barbarischen - Benehmens und
Auftretens verachten oder sie deswegen fürchten und bewundern, aber
sie gehören, sofern sie als Barbaren wahrgenommen werden, nicht der
Zivilisation derer an, die sich von ihnen durch den Barbarenbegriff
absetzen. Sie sind nicht nur anders und fremd, sondern sie stehen in
ihrer Andersartigkeit und Fremdheit auch prinzipiell unter der eigenen
Zivilisation. Bezeichnet Fremdheit zunächst nur soziale
Nichtzugehörigkeit oder kulturelle Unvertrautheit, so wird im Begriff
des Barbaren beides auf einer hierarchischen Ebene sortiert: Wer von
Fremden als Barbaren spricht, weiß über sie einiges (oder gibt dies
zu wissen doch zumindest vor), und vor allem weiß er eines: daß die
als Barbaren Bezeichneten, von dem, der sie als solche bezeichnet,
ungleich weniger wissen als er über sie und daß sie das, was sie
wissen, in der Regel nicht verstehen. Das definiert sie als Barbaren.
Der Barbarenbegriff ist ein Strategem soziokultureller
Distanzerklärung, verbunden mit der Versicherung der eigenen
Überlegenheit. Seine Verbreitung in den Diskursen der Humanisten des
15. und 16. Jahrhunderts wird zur Zeit in einem von der VW-Stiftung
finanzierten Projekt im Fachgebiet »Theorie der Politik« der
Humboldt-Universität zu Berlin untersucht.
Symbol und Symptom: Das Geschlecht der Zeichen
Christina von Braun
Heft 1/99, S. 34-39.
abstract
Das geistige und wissenschaftliche Denken im Abendland ist
gekennzeichnet von einer langen Tradition, die in der griechischen
Antike - etwa mit Platon - ihren Anfang nimmt und in der die Dichotomie
Geist und Natur von der Dichotomie Männlichkeit und Weiblichkeit
überlagert wird. Anders ausgedrückt: Die Vorstellung, daß Geist und
Materie als Gegensätze zu betrachten sind und der Geist den Körper zu
beherrschen habe, fand ihren Ausdruck und ihre Anbindung an eine
sichtbare Wirklichkeit in der Geschlechterdifferenz. Männlichkeit
wurde zur Symbolgestalt für das Geistige; Weiblichkeit zur
Symbolgestalt für den Körper, die Materie, das sterbliche Fleisch.
Von dieser Differenz leiten sich wiederum viele andere Dichotomien ab
wie etwa rational/irrational, gesund/krank, rein/unrein usw..
Diese Denkstruktur zog sich von der griechischen Antike über das
Christentum bis in die Neuzeit und Moderne, und sie nahm dabei
wechselnde Formen an, die sich in kirchlichen wie in politischen, in
künstlerischen wie in wissenschaftlichen Zusammenhängen zeigen. Was
bildete die Grundlage für die Wirkungsmacht dieser Denkstruktur?
Umweltverschmutzung durch
Verkehrsemissionen:
Der Beitrag der Geschichtswissenschaften zur Umweltforschung
Elfi Bendikat
Heft 1/99, S. 40-43.
abstract
Sommersmog, Ozonalarm, ökologisch verträgliche Mobilität in
Stadtregionen, von Luftschadstoffen ausgehende Gesundheitsrisiken ? -
das sind nur einige Stichworte zum aktuellen Thema Stadtökologie.
Verkehrsemissionen wurden bislang nur für die Massenmotorisierung der
Nachkriegszeit erforscht, für die »Vorläufer« galt dies nicht.
Diese Lücke soll ein Forschungsprojekt am Institut für
Geschichtswissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin
schließen.
Vom Palmblatt zum elektronischen Corpus: Die Südostasiatischen Philologien
Christian Bauer
Heft 1/99, S. 44-48.
abstract
Die »Südostasiatischen Philologien« werden an der
Humboldt-Universität zu Berlin durch eine Professur und mehrere
Mitarbeiter vertreten. Die derzeitige Ausrichtung dieses Faches
konzentriert sich auf die Sprachen des südostasiatischen Festlandes,
wobei der Hauptakzent in der Forschungsarbeit auf den Mon-Khmer- und
Tai-Sprachen liegt. Der Begriff der ?Philologie? ist nicht nur im
deutschsprachigen Raum diffus: Wir sehen ihn als Synonym für
Linguistik, einer Linguistik, die sich einerseits der Erforschung der
historischen Entwicklung von Einzelsprachen und Sprachgruppen widmet,
deren Ergebnisse aber andererseits auf einer soliden empirischen
Analyse größerer Textcorpora beruhen. Konkret heißt dies:
historische (diachrone) Corpus-Linguistik. Um die historische
Entwicklung einer Sprache verfolgen zu können, müssen die frühesten
verfügbaren Dokumente identifiziert und kritisch ediert, gleichzeitig
moderne Dialekte und Varianten zum Vergleich herangezogen werden.
Insofern ist der Begriff ?Philologien? für unsere Arbeit an der
Humboldt-Universität durchaus zutreffend: beschäftigen wir uns doch
in der Praxis sowohl mit Epigraphik und Handschriftenedition als auch
mit deskriptiver Linguistik, wie z.B. der Beschreibung moderner
Dialekte.
Das Neue Europa: Europäische Graduiertenprogramme an der Humboldt-Universität
Gert-Joachim Glaeßner
Heft 1/99, S. 50-57.
abstract
Das neue Europa ist ein neues »Gesamteuropa«, das seit 1989 mit
der Erbschaft des kommunistischen Systems und einer mehr als
vierzigjährigen Geschichte des mittel- und osteuropäischen Raumes zu
tun hat. Die gesellschaftlichen, politischen, ökonomischen und
kulturellen Veränderungsprozesse in diesem Raum beeinflussen die
Entwicklung des ursprünglichen westlichen »Kerneuropa« in neuer
Weise. Die Fragen, welche die Entwicklung eines neuen Gesamteuropa
aufwerfen, stehen im Mittelpunkt mehrerer Graduiertenstudiengänge an
der Humboldt-Universität zu Berlin.
![]() TECHNOLOGIETRANSFER
TECHNOLOGIETRANSFER
Messe-Exponate der Humboldt-Universität auf der CeBIT:
DISSY - Personaleinsatzplanung im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)
Hans-Jürgen Prömel/Mark Proksch/Björn
Karge
Heft 1/99, S. 58f.
abstract
Im Projekt DISSY wird ein Decision-Support-System für die
Dienstreihenfolgeplanung im öffentlichen Personennahverkehr entwickelt
und evaluiert, das bei der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) zum Einsatz
kommen wird. Bei der Dienstreihenfolgeplanung werden Dienstpläne für
Fahrergruppen mit Diensten (Schichten) gefüllt, wobei gesetzliche,
tarifvertragliche Regelungen und Betriebsvereinbarungen, insbesondere
zu Ruhezeiten und maximalen Arbeitszeiten zu beachten sind. Darüber
hinaus möchte die BSAG durch Berücksichtigung individueller Wünsche
die Motivation ihrer Mitarbeiter erhöhen. Daraus ergibt sich ein
äußerst komplexes Optimierungsproblem. Abgesehen von einer
Unterstützung der üblichen Handplanung, stellt das System eine
automatische Optimierung bereit, wobei neben anderen Heuristiken vor
allem lokale Suchalgorithmen zum Einsatz kommen. Über die Planung
eines konkreten Fahrplanes hinaus erlaubt die automatische Optimierung,
verschiedene Planungsszenarien zu simulieren und zu studieren.
![]() TECHNOLOGIETRANSFER
TECHNOLOGIETRANSFER
Messe-Exponate der Humboldt-Universität auf der CeBIT:
The CORBA Management Network
Joachim Fischer/Frank Stoinski/Olaf
Kath
Heft 1/99, S. 60.
abstract
Gemeinsam mit Industriepartnern wurden Konzepte und Prinzipien des
Managements von Telekommunikationsnetzen unter Einsatz der
Distributed-Objects-Technologie entwickelt. Ausgehend von den Arbeiten
des RM-ODP werden die Ressourcen eines Netzes in den Informations-,
Computational- und Engineering-Systemsichten modelliert. Das Ergebnis
dieser Arbeiten, eine Framework-Implementierung für die Entwicklung
von Multimedia-Telekommunikationsdiensten in einer ATM-Umgebung, wird
in diesem Beitrag vorgestellt und auf der CeBit '99 demonstriert.

