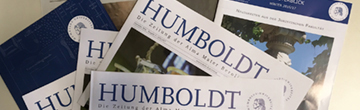„Es war der Versuch einer Selbsterneuerung“
Karin Lohr ist Außerplanmäßige Professorin am Lehrbereich „Soziologie der Arbeit und Geschlechterverhältnisse“ am Institut für Sozialwissenschaften. Im Interview erinnert sie sich an die Ereignisse vor 30 Jahren

Karin Lohr, Foto: Matthias Heyde
Frau Lohr, Sie kennen die Humboldt-Universität als Studentin und Wissenschaftlerin, vor und nach dem Mauerfall, Sie haben die Zeit der Selbsterneuerung live miterlebt. Welche Erinnerungen sind Ihnen im Gedächtnis geblieben?
Karin Lohr: Erinnerungen sind immer subjektiv. Die Wahrnehmung und Deutung der Vergangenheit ist abhängig von den jeweiligen individuellen Erfahrungen. In Erinnerungen behalten habe ich vor allem die Entwicklung der Soziologie und Sozialwissenschaften. Am 1979 gegründeten Institut für Marxistisch-Leninistische Soziologie habe ich mein Diplom in Soziologie erworben, promoviert und wurde habilitiert. Als die Mauer fiel, war ich dort Dozentin und Direktorin für Erziehung und Ausbildung, das ist vergleichbar mit der Position einer Studiendekanin.
Die Soziologie galt in der DDR als bürgerliche Wissenschaft, die die Partei mit Misstrauen betrachtete und klein hielt. Nur drei Professorinnen und Professorinnen, zwei Dozentinnen und Dozenten und rund 22 wissenschaftliche Mitarbeitende forschten und lehrten am HU-Institut. Wir hatten nur 20 Studierende pro Jahrgang. Insgesamt gab es nur drei Universitäten, an denen man einen Abschluss in Soziologie erwerben konnte. Die Soziologie als „Hilfswissenschaft“ beschränkte sich weitgehend auf empirische Sozialforschung, am Institut vor allem im Bereich von Arbeit, Industrie und städtischer Lebensweise. Übergreifende gesellschaftsdiagnostische Analysen aus soziologischer Perspektive waren nicht erwünscht.
Im November 1989 fiel die Mauer. Was passierte an Ihrem Institut?
Lohr: Die Studierenden waren erst einmal weg. Sie gingen vor allem an die Freie Universität, um dort Lehrveranstaltungen in den Sozialwissenschaften zu besuchen. Aber das währte nicht lange, die meisten kamen schnell wieder zurück. Sie waren eine Massenuniversität nicht gewohnt, das System überforderte sie. Zeitgleich kamen Professoren der Soziologie (und es waren nur Männer) von westdeutschen Universitäten an unser Institut. Sie wollten bei der Erneuerung mitwirken, führten Gast-Lehrveranstaltungen durch, erste gemeinsame Forschungsprojekte wurden angeschoben, bereits bestehende Kontakte ausgebaut. Das war einerseits hilfreich, aber in einigen Fällen gab es auch Versuche der Übernahme.
Die ganze Universität war im Auftrieb.
Lohr: Ja, ich finde, dass der Begriff der Selbsterneuerung auf die Zeit vom November 1989 bis Oktober 1990 gut zutrifft. Genauer gesagt: Es war der Versuch einer Selbsterneuerung. Es gab einen Runden Tisch, an dem Vertreterinnen und Vertreter aller Statusgruppen teilnahmen. Alle Gremien (Studierendenräte, Instituts- und Fachbereichsräte, ein universitätsweiter Rehabilitations- und ein Ehrenausschuss u.a.) wurden frei gewählt. Es wurden eigene Personal- und Strukturkommissionen gebildet, die anfingen, das Personal zu evaluierten, der Universität eine neue Struktur zu geben und es wurde ein Statut der HU erarbeitet. So entstand ein neuer Fachbereich Sozialwissenschaften, in dessen Folge auch heute noch das Institut für Sozialwissenschaften der KSBF existiert. Die Universität versuchte, einen eigenen, selbstbestimmten Weg zu gehen. Es gab aber auch kritische Medienkampagnen und Bestrebungen von außerhalb, die Universität Unter den Linden zu liquidieren. Diesen Forderungen hat die Senatsverwaltung für Wissenschaft jedoch nicht entsprochen.
Mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik am 3. Oktober 1990 veränderten sich die rechtlichen und politischen Spielregeln für den Umwandlungsprozess. Nun galt das Westberliner Hochschulgesetz auch für die Humboldt-Universität. Was bedeutete das für die Sozialwissenschaften und das Institut für Soziologie?
Lohr: Im Dezember 1990 beschloss der Berliner Senat die Abwicklung der Fächer der HU und 1991 den Einsatz von Struktur- und Berufungskommissionen, die jeweils zur Hälfte mit West und Ost-Professorinnen und -Professoren besetzt waren, außerdem war jeweils eine wissenschaftliche Mitarbeiterin und Mitarbeiter und eine Studentin und ein Student vertreten. Die Leitung übernahmen jeweils westdeutsche „Planungsbeauftragte“. Auch die Sozialwissenschaften wurden durch eine solche Kommission unter Leitung des westdeutschen Soziologen Friedhelm Neidhardt evaluiert. Das heißt, Personen wurden fachlich und politisch beurteilt, eine thematische Struktur entwickelt, neue Prüfungs- und Studienordnungen erarbeitet und Neuberufungen durchgeführt.
War denn eine fachliche Beurteilung möglich?
Lohr: Da für die Soziologie die Publikationsmöglichkeiten stark beschränkt waren, weder eine Fachzeitschrift noch eine Fachgesellschaft existierte und viele Forschungsergebnisse in Panzerschränken verschwunden waren, war es schwer, Forschende zu evaluieren. Die Kommission betrachtete deshalb vor allem ihr Wirken nach 1989 sowohl beim Umbau der Universität als auch in Lehre und Forschung. In diesem Prozess wurde inhaltlich durchaus an die 1990 entwickelten Ideen und Konzepte angeschlossen, auch wenn insgesamt im Prinzip das westdeutsche Hochschulsystem übertragen wurde.
Für viele Angehörige von DDR-Hochschulen endete die Karriere nach der Wiedervereinigung. Was waren neben inoffizieller IM-Tätigkeit weitere Gründe für den Verlust der Arbeitsstelle?
Lohr: Wer in Stasimachenschaften verstrickt war, musste gehen. Aber auch eine SED-Mitgliedschaft oder eine Parteifunktion konnte dazu führen, dass es die Evaluierten viel schwerer hatten zu bestehen. Vor allem Ältere, die besonders durch das politisch-ideologische System geprägt waren, hatten es schwer, sich neu zu orientieren und entsprechende Kompetenzen in Lehre und Forschung zu entwickeln.
Die Humboldt-Universität zählt heute zu den führenden Universitäten Deutschlands. Wie hat sie das geschafft?
Lohr: Der Humboldt-Universität eilte schon immer ihr guter Ruf voraus. Auch zu DDR-Zeiten war sie national und international anerkannt. Das änderte sich auch nach 1990 nicht. Als ich Mitte der 1990er in Paris an der Science Po war, konnte man auf einem Schaubild im Foyer sehen, dass die Humboldt-Universität mit Elite-Universitäten wie Cambridge und Harvard als Referenz für die internationale Kooperation der Pariser Elitehochschule aufgeführt wurde.
Dieser traditionelle Ruf der Universität und der Standort in der Hauptstadt hat sicher auch dazu geführt, dass hochrangige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Ruf angenommen haben und Lust hatten, aus dem tradierten System der alten Bundesrepublik auszubrechen und in Berlin etwas Neues aufzubauen. In Ostdeutschland wurden viele hochschulpolitische Diskussionen darüber geführt, ob die Neuberufenen die zweite Garde aus Westdeutschland waren. Für die Humboldt-Universität kann man das nicht behaupten. Ostdeutsche Universitäten mit weniger Tradition hatten es da schwerer.
Wird der Erneuerungsprozess der ostdeutschen Universitäten erforscht? Was steht im Fokus der Diskussion?
Lohr: Es wurde meines Erachtens nach relativ wenig dazu geforscht. Dabei wäre es notwendig, die Vergangenheit aufzuarbeiten und verpasste Chancen anzuschauen, um aktuelle Probleme wie Massenuniversität, steigende Studierendenzahlen – bei gleichbleibenden personellen Kapazitäten, Bürokratisierung etc. besser in den Griff zu bekommen.
Karin Lohr (Jahrgang 1954) ist Außerplanmäßige Professorin am Lehrbereich „Soziologie der Arbeit und Geschlechterverhältnisse“ am Institut für Sozialwissenschaften. Im Mittelpunkt ihrer Forschung stehen unterschiedliche Transformationsprozesse, zum Beispiel bezüglich des Wandels von Arbeit in der Wirtschaft, aber auch im Bildungswesen.
Interview: Ljiljana Nikolic
Literaturhinweis
Hellmut Wollmann: Soziologie an der Humboldt-Universität unter dem SED-Regime und in der „Wende“. In: Tenorth, Heinz-Elmar (Hg.): Geschichte der Universität Unter den Linden 1810-2012. Selbstbehauptung einer Vision. Akademie Verlag Berlin 2010