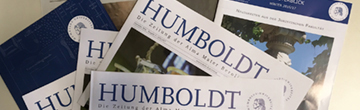„Die grundgesetzlich garantierte Forschungs- und Wissenschaftsfreiheit war ein echter Qualitätssprung“
Der Chemiker Udo Hartmann ist leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit in der Technischen Abteilung der Humboldt-Universität.
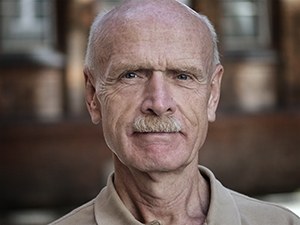
Udo Hartmann, Foto: Martin Ibold
Udo Hartmann kam nach einem Chemie-Studium in Dresden 1985 als Wissenschaftlicher Assistent in einer Arbeitsgruppe, die sich mit Photochemischen Fragen befasste, an die Humboldt-Universität. Heute ist er leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit in der Technischen Abteilung der Humboldt-Universität.
Herr Hartmann, wie haben Sie die Veränderungen in der Zeit nach der Wende bis zur Wiedervereinigung erlebt?
Udo Hartmann: Wir hatten nach Maueröffnung relativ schnell Kontakt zu Fachkollegen an FU und TU. Die Forschungsgegenstände an sich waren vielleicht anders strukturiert in Ost und West, aber ansonsten durchaus vergleichbar. Einen deutlichen Unterschied gab es in Bezug auf die gerätetechnische Basis. Da lagen zwischen uns Welten. In der DDR war es immer mit großen Anstrengungen verbunden, an moderne Geräte zu kommen, an Spektrometer, Chromatographen, denn das waren Westimporte. Ab 1990 merkte man dann in beide Richtungen eine gewisse Fluktuation. Die ersten Hochschullehrer und Kollegen gingen weg.
Können Sie sich noch an die damaligen Debatten über den Umbau der Humboldt-Uni erinnern?
Hartmann: Ja, die gab es ständig. Auch bei uns am Institut für Chemie. Viele haben das Bild von den „kreisenden Geiern aus dem Westen" bemüht. Und es gab viele "Westimporte". Dazu die Überprüfungen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch wenn die Chemie eine naturwissenschaftliche Einrichtung war, so gab es doch eine enge Verquickung von Staat, Überwachungsorganen und Hochschullehrern. Das war in der DDR ziemlich massiv. Aber die genauen Gründe dafür, warum Leute gehen mussten, manche von heute auf morgen, die waren uns nicht immer klar. Die Wissenschaftler mussten vor Kommissionen treten, wir alle mussten uns noch einmal auf unsere Stellen bewerben. Viele empfanden das als demütigend.
Aber Sie blieben?
Hartmann: Ich war noch in der Qualifikationsphase. Ich wollte meine Promotion irgendwie fertigkriegen und die Personalstrukturkommission hat damals entschieden, dass ich eine Festanstellung zunächst bis 1992 bekomme.
Worin sahen Sie die größte Herausforderung?
Hartmann: Der gesamte universitäre Betrieb wurde auf bundesdeutsches Recht umgestellt, was ziemlich kompliziert war. Denn wir hatten im Osten zum Beispiel eine bessere Personalausstattung für technisches Personal, Laboranten, chemisch-technische Assistenten und so weiter.
Ein echter Qualitätssprung war die grundgesetzlich garantierte Forschungs- und Wissenschaftsfreiheit, der Staat hält sich raus aus den Hochschulen, weg mit Dirigismus und Kontrolle. Denn das alles gab es zu DDR-Zeiten an der Humboldt-Uni.
Im Jahr 2007 sind Sie in die Verwaltung der Humboldt-Uni gewechselt - warum?
Hartmann: Ich hatte vorher befristete Verträge. Zuletzt als Ingenieur für Forschung mit acht Lehrverpflichtungsstunden in der Woche. Meine Stelle war eine so genannte kw-Stelle (Stelle mit Wegfallvermerk, d.Red.), und die Personalabteilung versuchte dann, den Leuten im Personalüberhang eine Stelle innerhalb der Uni anzubieten. Das war schon eine faire Geschichte.
Für eine Stelle in der Technischen Abteilung hieß es zuerst: Der Hartmann ist überqualifiziert. Als dann aber die Vorgängerin in meinem heutigen Job ausscheiden wollte, fragte sie mich, ob ich nicht als Leitende Fachkraft einsteigen wollte. Ich habe darüber intensiv nachdenken müssen, denn ich habe meine Arbeit in Adlershof geliebt. Ich bin gewechselt und habe ein nebenfachliches Studium absolviert, zur Fachkraft für Arbeitssicherheit.
Empfanden Sie den Wechsel als Bereicherung?
Hartmann: Auch dieser Job macht Spaß, man lernt die Uni auf neue Weise kennen, mit all dem Baugeschehen, mit Laboreinrichtungen, biologischer Sicherheit, mit Kontakt zu Behörden. Das ist durchaus anspruchsvoll. Im Ganzen gesehen hatte ich Glück, dass es so gelaufen ist.
Sie sind jetzt 62 Jahre alt. Wären Sie vor 30 Jahren Berater gewesen für den Umbau der Humboldt-Uni: Was hätten Sie anders gemacht, wie wären Sie vorgegangen?
Wichtig ist immer zu schauen: Was machen die Leute, wie machen sie es und vor allem: warum? Ich würde beraten, empfehlen, aber mein System nicht anderen überstülpen.
Wenn man sich heute Unis in Osteuropa anschaut, in all den Ländern, die vor 30 Jahren keinen wirtschaftlich „starken Bruder“ hatten, dann kann man sehen: Der Umbau hat zwar viel länger gedauert, am Ende aber auch funktioniert.
Interview: Frank Aischmann