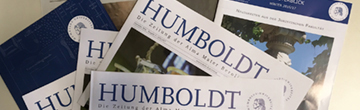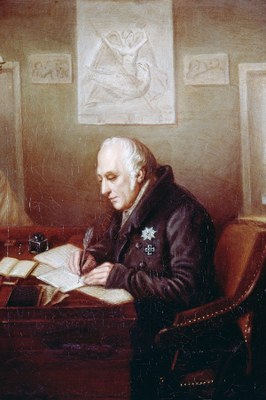In der Welt zuhause
Humboldt erforschte die Struktur von rund 75 Sprachen – ohne Europa zu verlassen
„Der Ausgangspunkt für Wilhelm von Humboldts sprachwissenschaftliche Arbeit war das Baskische, die exotischste Sprache in Europa“, sagt Professor Jürgen Trabant. „Diese totale Alterität im Vergleich zu den anderen Sprachen des Kontinents hat ihn richtig aufgeregt. Deshalb ist der 33-Jährige 1801 sogar ins Baskenland gereist, um herauszufinden, wie dieses Volk, das so merkwürdig spricht, lebt.“
Trabant hat an der FU Berlin Romanistik gelehrt, seit zwölf Jahren leitet er das an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften angesiedelte DFG-Projekt „Wilhelm-von-Humboldt-Ausgabe: Schriften zur Sprachwissenschaft“– eine auf über 20 Bände angelegte historisch-kritische Edition von Humboldts linguistischen Schriften, die größtenteils aus dem Nachlass stammen, drei Bände sind fürs Baskische reserviert. Trabant erklärt dessen Andersartigkeit: „Es ist eine isolierte Sprache, mit den indoeuropäischen Sprachen nicht verbunden, der Wortschatz bis auf Lehnwörter aus dem Lateinischen und Spanischen unbekannten Ursprungs. Es ist eine Ergativsprache.“ Außerdem weise es eine unglaublich reiche, komplizierte Morphologie auf.
Sprache strukturiert die Welt
Vom Baskischen ausgehend hat Wilhelm von Humboldt vor allem während seiner letzten fünfzehn Lebensjahre in seinem Tegeler Haus rund 75 weitere Sprachen untersucht. Er hat sich mit ungefähr 30 Eingeborenensprachen Amerikas, 20 europäischen, dem Ägyptisch-Koptischen, mit Sanskrit, Japanisch und Chinesisch beschäftigt, schließlich mit den austronesischen Sprachen, die im Pazifik und Indik gesprochen werden. Insgesamt verfügte der äußerst sprachbegabte und etliche Fremdsprachen beherrschende Gelehrte über Materialien zu fast 200 Sprachen, meist in Form von Wörterbüchern und Grammatiken.
„Er hatte ein systematisches Sprachmaterialbesorgungsprogramm“, erklärt der Professor, „ein großes Netz von Bekannten, die ihm von allen Erdteilen Unterlagen schickten – diese bestimmten, mit welchen Sprachen er sich auseinandersetzte“. So hat ihm sein Bruder Alexander von seiner Amerikaexpedition zwölf Bücher mitgebracht, darunter ein Wörterbuch und zwei Grammatiken des Náhuatl. Gleichwohl seien die damals verfügbaren Grammatiken oft nur Skizzen mit Wörterlisten gewesen, und dass literarische Texte meist fehlten, lief Humboldts ganzheitlichem Anspruch zuwider. „Für ihn ist eine Sprache ein Individuum. Sie allein anhand der Grammatik, die er ‚das tote Gerippe‘ nannte, zu erfassen, ist sehr schwierig.“ Mit seinen synchronisch-strukturellen Studien habe er zeigen wollen, wie vielfältig der menschliche Geist sei. „Sprache“, so erläutert Prof. Trabant, „strukturiert die Welt, sie ist ein erstes Gegebensein des Denkens.
Weltansichten nennt Humboldt die Sprachen. Aber man kann über die Einzelsprachen, die eine volkstümliche Art des Denkens sind, hinausgehen, man spricht ständig über Neues, indem man alte Worte verwendet.“ Humboldts Ansatz, fasst der Projektleiter zusammen, sei „eindeutig ein moderner und philosophischer“ gewesen.
Humboldts Einfluss auf die Linguistik
Was also bleibt vom Sprachforscher Humboldt? Sein Hauptwerk ist „Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwickelung des Menschengeschlechts“ von 1836, die Einleitung zu seinem postum erschienenen mehrbändigen Werk „Über die Kawi-Sprache auf der Insel Java“. Mit seiner Unterscheidung der morphosyntaktischen Verfahren von Flexion, Isolierung, Einverleibung und Agglutination hat er die linguistische Typologie beeinflusst.
Die einzige Grammatik, die er vollendet hat, ist die des Náhuatl –dazu hat er dessen Phonologie sowie die Morphologie und Syntax nach Wortarten beschrieben, zudem eine Gesamtcharakteristik versucht. Anhand der „Mexicanischen Grammatik“ könne man laut Trabant seine empirische Vorgehensweise gut erkennen. „Mein persönlicher Lieblingstext“, so der Romanist, „ist die erste Akademie-Rede. Humboldt war ja kein Professor, er hatte keine Schüler und kaum publiziert. Aber 1820 begann er, an der Akademie Vorträge zu halten – die wurden dann veröffentlicht und ermöglichen es, seine Reise durch die Sprachen nachzuverfolgen.“
Froh ist Trabant, dass pünktlich zum 250. Geburtstag im Juni, wenn auch das DFG-Projekt ausläuft, die Hälfte der Humboldt-Edition publiziert sein wird. „Das Herz haben wir geschafft, sechs Bücher über die amerikanischen Sprachen und zwei über das Baskische.“ Vor allem bleibt von Humboldt eine neue Ansicht von den Sprachen der Welt, „nämlich dass sie den Reichtum des menschlichen Geistes ausmachen und deswegen kostbare und bewahrenswerte Geschöpfe der menschlichen Kultur sind“.