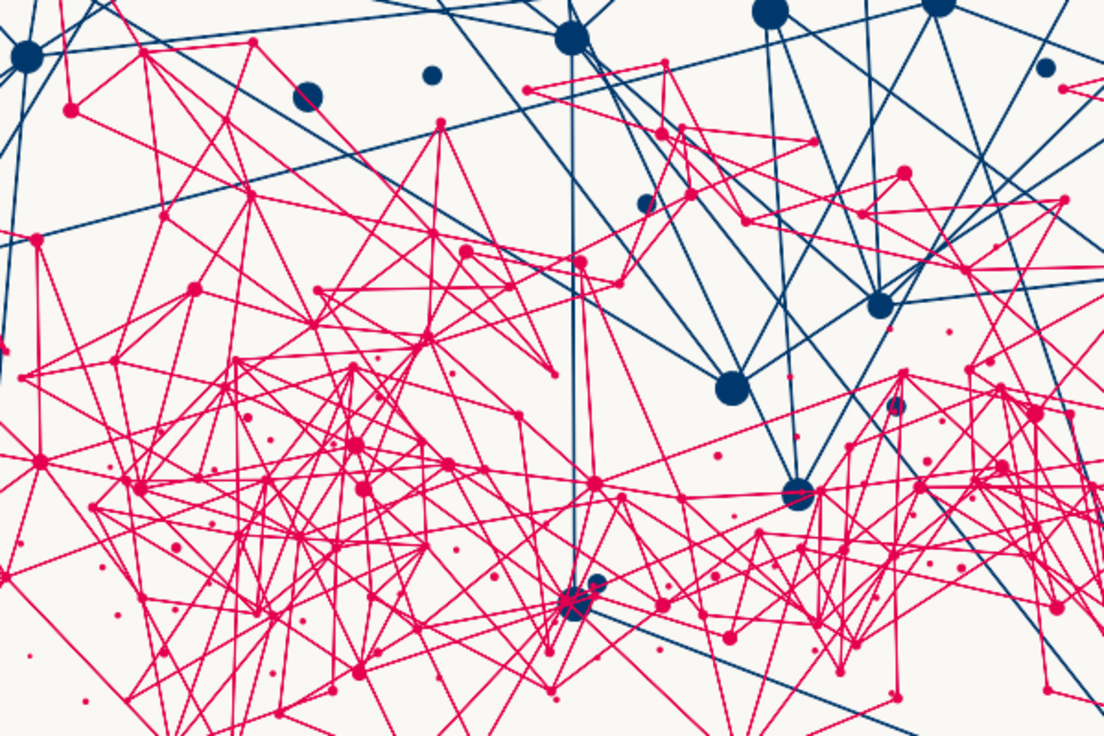Um den vielfältigen Chancen und Herausforderungen zu begegnen, die die Entwicklung Künstlicher Intelligenz bereithält, wird an der Humboldt-Universität zu verschiedensten Fragestellungen geforscht. Auch in der Lehre spielt die Auseinandersetzung mit KI eine immer größere Rolle – nicht nur in den Naturwissenschaften.
Längst ist Künstliche Intelligenz im Alltag angekommen – sei es bei der Steuerung von Staubsaugern oder der Vorhersage von Schadstoffkonzentrationen in der Umwelt. In aktuellen Debatten würden vor allem Risiken thematisiert, sagt Prof. Dr. Christoph Schneider, Vizepräsident für Forschung der Humboldt-Universität. „Doch bietet KI auch die Chance, ökonomisch und sozial bedeutsame, nachhaltige und gemeinwohlorientierte Entwicklungen voranzutreiben. Daher ist es essentiell, dass wir durch Forschung an der HU KI als Schlüsseltechnologie auf einer breiten fachlichen Basis erforschen – dass wir also die Vielfalt an KI- und IT-Anwendungen verstehen, mitgestalten und kritisch beurteilen.“
Schließlich habe die Universität den gesellschaftlichen Auftrag, in der Forschung zum Erhalt und zur Verbesserung der menschlichen Lebens- und Umweltbedingungen beizutragen und die Voraussetzungen und Folgen von Forschungsergebnissen zu reflektieren. Auch gehe es darum, als Berliner Universität im internationalen Vergleich wettbewerbsfähig zu sein. „Wirft man einen Blick in den Koalitionsvertrag der amtierenden Berliner Regierung, soll Berlin in den nächsten Jahren bundesweit als führender Standort für KI etabliert werden“, sagt Schneider.
Als Teil der Berlin University Alliance (BUA) und im Zuge zahlreicher Kooperationen mit Forschungseinrichtungen sei die Humboldt-Universität in der KI-Forschung sehr gut vernetzt. So seien HU-Wissenschaftler:innen beispielsweise als Principal Investigators am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft, am Einstein Center for Digital Futures (ECDF), der Graduiertenschule Helmholtz-Einstein International Berlin Research School in Data Science (HEIBRiDS), am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft und am Berlin Institute for the Foundations of Learning and Data (BIFOLD) beteiligt. Zudem ist die HU Berlin Teil des Künstlichen Intelligenz Entrepreneurship Zentrums (K.I.E.Z.), das Gründungspotenziale in der KI-Forschung auslotet.
„Die Humboldt-Universität zeichnet sich im Bereich der KI-Forschung durch eine große thematische Bandbreite aus“, sagt Schneider. Vor dem Hintergrund der komplexen technologischen, gesellschaftspolitischen und ethischen Herausforderungen sei eine solche Diversität der Zugänge wichtig. In der Informatik beispielsweise werde die KI-Forschung insbesondere durch Prof. Dr. Thomas Kosch, Prof. Dr. Alan Akbik und den Einstein-Profil-Professor Jan Mendling vorangetrieben. In den Rechtswissenschaften forscht Prof. Dr. Herbert Zech, Professor für Bürgerliches Recht, Technik- und IT-Recht und Direktor des Weizenbaum-Instituts für die vernetzte Gesellschaft, zusammen mit seinem Team zu rechtlichen Problemen der digitalen Transformation im Bereich Big Data und Künstlicher Intelligenz.
„In den Geistes- und Sozialwissenschaften sind etwa der Sozialwissenschaftler Prof. Dr. Philipp Staab, der sich in einem Projekt der politischen Ökonomie der Künstlichen Intelligenz widmet, und das am Institut für Medien- und Musikwissenschaft bei Prof. Dr. Shintaro Miyazaki angesiedelte und von Anna-Verena Nosthoff und Felix Maschewski geleitete Critical Data Lab zu nennen“, sagt Schneider.
Auch an der Philosophischen Fakultät gibt es eine Tradition der Digital Humanities mit Bezug zu KI. Seit 2017 forscht Prof. Dr. Robert Jäschke im Themenfeld von Information Processing und Analytics am Institut für Informations- und Bibliothekswissenschaft. Im Jahr 2020 wurde am Institut für Geschichtswissenschaften eine der ersten dezidiert der Digital History gewidmeten Professuren in Deutschland eingerichtet, die der Historiker Prof. Dr. Torsten Hiltmann innehat. „Aktuell erforschen wir, wie man die vielfältigen Methoden und Möglichkeiten der KI auch für die Geschichtswissenschaften sinnvoll und methodisch reflektiert nutzbar machen kann“, sagt Hiltmann. Unter anderem gehe es darum, mithilfe Verfahren des maschinellen Lernens in mittelalterlichen Handschriften wie auch in anderen Quellen automatisiert Wappendarstellungen zu finden und mit Anmerkungen versehen zu können. Auch werde zur KI-basierten Erschließung von mittelalterlichen Stundenbüchern und Urkunden geforscht. „Zudem arbeiten wir mit unterschiedlichen, KI-basierten Methoden wie Autorschaftsanalyse, aber auch zur Wiederverwendung von Texten in Texten – am Beispiel der Bibel in spätmittelalterlichen Traktaten.“ Forschung mit und zu KI spielt also nicht nur in den Naturwissenschaften eine Rolle. Im Juli 2023 habe das Interdisziplinäre Zentrum Digitalität und digitale Methoden seine Arbeit aufgenommen und werde in den nächsten Jahren die Forschungsaktivitäten im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften verschiedener Fakultäten rund um Digitalität und digitale Methoden bündeln und verstärken, sagt Christoph Schneider.
Auch in der Lehre werde die Auseinandersetzung mit KI immer stärker verankert, sagt Prof. Dr. Niels Pinkwart, Vizepräsident für Lehre und Studium. „Zu einer modernen Ausbildung gehört zu betrachten, welche informationstechnologischen Möglichkeiten wir haben und wie diese für die jeweiligen Fachgebiete sinnvoll nutzbar gemacht werden können.“ Diesem Ziel widmet sich seit Ende 2021 das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Projekt AI-SKILLS, das Möglichkeiten für Lehrende schafft, um sich über KI-Themen und Lehrkonzepte zu informieren und auszutauschen – beispielsweise in einer Moodle-Gruppe und Workshops. Außerdem werden Lehrangebote zu KI-Themen zusammengestellt, wodurch Studierende und Lehrende mit einem Zertifikat belegen können, dass sie sich mit diesen Themen in der Tiefe auseinandergesetzt haben, sagt Dr. Lilian Löwenau, Projektleiterin von AI-SKILLS. „Damit bestätigt die Universität den Lehrenden und Studierenden, dass diese sich mit Grundlagen von KI und Machine Learning auseinandergesetzt und eine informierte Haltung entwickelt haben“, sagt Dr. Löwenau.
Um als mündige:r Bürger:in KI-Verfahren einschätzen zu können, brauche es Wissen. Deshalb sei es wichtig, sich in der Hochschullehre mit Künstlicher Intelligenz zu beschäftigen. „Die ungeheuerlichen Fähigkeiten solcher Verfahren bringen große Vorteile, auch für die Wissenschaft, aber man muss sich auch mit den – beispielsweise – ethischen Problemen auseinandersetzen“, sagt Diplom-Informatiker Jan Krämer, der als sogenannter Community-Katalysator Ansprechpartner für Informatik und Naturwissenschaften ist. Lehrende aller Fachbereiche können sich bei AI-SKILLS mit Fragen rund um KI-Themen und Lehre melden. Das Projektteam sammelt und konzipiert entsprechende Lehr- und Lernmaterialien. „Damit Lehrende von der Erfahrung der anderen profitieren und darauf aufbauen können“, sagt Dr. Löwenau. Außerdem wird ein JupyterHub als Plattform für interaktive wissenschaftliche Datenauswertung und Programmierübungen für Lehrveranstaltungen bereitgestellt, auf den Lehrende und Studierende in Zukunft über einen Webbrowser zugreifen können. Lernmaterialien bietet auch KI-Campus, eine öffentlich zugängliche Lernplattform mit kostenlosen Online-Kursen, Videos und Podcasts. In der zweiten Förderphase des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekts beteiligt sich auch die Humboldt-Universität – unter anderem durch die Weiterentwicklung bestimmter KI-Campus-Lernformate für die Hochschullehre. Ein Beispiel ist ein Kurs zum Thema KI und Leadership, den Niels Pinkwart, Wissenschaftlicher Leiter des Projekts, mit einer Kollegin anbietet. Neu sei, dass dabei Elemente von Online- und Präsenzlehre miteinander verknüpft werden. „Das interaktive Seminar-Szenario soll ein Miteinander ermöglichen und über den reinen Online-Kurs hinausgehen“, sagt Pinkwart.
KI ist inzwischen ein wichtiges Thema in der Lehre. Wie aber kann die Lehre selbst von KI-Technologien profitieren? Damit beschäftigt sich das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Verbundprojekt IMPACT, an dem auch die Goethe-Universität Frankfurt, die FernUniversität Hagen, die Freie Universität Berlin und die Universität Bremen beteiligt sind. In einem Teilprojekt an der Humboldt-Universität geht es um formatives Feedback – Rückmeldungen, die während des Lernprozesses gegeben werden. „Es ist essenziell, dass Lernende nicht erst am Ende des Semesters Feedback erhalten. Lehrende haben aber häufig keine Zeit, zwischendurch Rückmeldungen zu geben“, sagt Leo S. Rüdian von IMPACT. Ziel sei deshalb, mithilfe von KI Feedback zu Hausaufgaben zu generieren, die Studierende während des Semesters verfassen. Wichtig sei dabei, dass die KI nach transparenten Kriterien arbeite, die von den Rückmeldungen der Lehrenden abgeleitet werden, sagt Rüdian. „Wir können und wollen die Lehrenden nicht ersetzen. Es geht darum, ihnen ein Werkzeug in die Hand zu geben, um den Feedback-Prozess zu beschleunigen“, sagt Rüdian. Generell sei das Bewusstsein für KI-Themen unter Lehrenden und Studierenden mit dem Hype um ChatGPT gewachsen, sagt Jan Krämer von AI-SKILLS. „Das ist Fluch und Segen zugleich. Einerseits freuen wir uns über das Interesse. Andererseits wollen wir auch Aufmerksamkeit auf andere Bereiche lenken, wie etwa die notwendigen Fähigkeiten, die es braucht, um im Spannungsfeld automatisierter statistischer Verfahren und der guten wissenschaftlichen Praxis erfolgreich zu navigieren. Denn es gibt noch mehr als ChatGPT.“
Text: Inga Dreyer